The Tree of Life
(TERRENCE MALICK, USA 2011)
[fvplayer src=“https://youtu.be/E6n_eEuo2is“]
Eine Filmbesprechung von Prof. Dr. Michael Schramm
Lehrstuhl für Katholische Theologie und Wirtschaftsethik, Universität Hohenheim.
Wiedergabe mit freundlicher Genehmigung des Autors
Am Anfang war der Riss in der Schöpfung. TERRENCE MALICKs neuestes Opus konfrontiert uns gleich zu Beginn mit diesem Riss: Nachdem ein Zitat aus dem Buch Hiob daran erinnert hat, dass (zumindest den monotheistischen Religionen zufolge) die Fundamente der Erde durch Gott den Schöpfer gelegt wurden (Hiob 38,4), bricht unvermittelt die Nachricht vom Tod ihres neunzehnjährigen Sohnes in das Leben der Familie O’Brien. Das Leben geht weiter, doch der Riss bleibt. In der Wirklichkeit dieser Schöpfung gibt es die Gnade des Lebens nicht ohne den Riss des Verschwindens, nicht ohne den Riss der Grausamkeit des Todes.
Kurz nach diesem Intro (sowie auch bereits im Trailer) liefert uns MALICK die grundsätzliche Philosophie dazu: Es gebe zwei Wege durch das Leben, klärt uns eine Stimme aus dem Off auf, den „Weg der Natur“ und den „Weg der Gnade“. Obgleich es sich hierbei um ein klassisches Begriffspaar der traditionellen Theologie handelt (das Mrs. O’Brien von Nonnen beigebracht wurde), ist am Anfang noch nicht so ganz klar, was diese duale Metaphysik in MALICKs Universum bedeuten soll. Doch mit der Zeit wird deutlich, dass diese widerstreitenden „Wege“ den ganzen Film durchziehen – im Großen (dem Universum) wie im Kleinen (dem Leben der Familie O’Brien). In einer überwältigenden und meist nicht computergenerierten Bilderflut – für die zum Teil DOUGLAS TRUMBULL verantwortlich war, der bereits Effekte zu STANLEY KUBRICKs berühmtem „2001“ beisteuerte – widmet sich der Film in einem ersten „Teil“ zunächst dem ganz Großen, dem Makrokosmos: der Entstehung des Universums und der Naturgeschichte unseres Planeten, der Begegnung von brennender Lava und wogenden Ozeanwellen, der Schönheit und Grausamkeit des Lebens auf der Erde, blutig aufgerissenen Dinosauriern, die dann allesamt durch einen Meteoreinschlag ausgelöscht werden, bis hin zum Mikrokosmos der Familie O’Brien, in deren (vermeintliches) Idyll die Todesnachricht einbricht. Und es wird deutlich: Der „Weg der Natur“ ist der grausam gleichgültige Welt der Gesetze von Natur und Evolution, der mitleidslose „Kampf ums Dasein“ (struggle for life), das harte Verfolgen der eigenen Interessen auch auf Kosten der anderen, das Zubeißen und Zuschlagen. Anders der „Weg der Gnade“, der den anderen barmherzig in den Blick nimmt, das warmherzige Verstehen, die Liebe.
TERRENCE MALICK hat sich nichts Geringeres vorgenommen als mit diesem Film ein Meisterwerk über alles zu erschaffen – ein geradezu irrwitzig anmutendes Projekt, das die Zuschauer entzweien wird und das auch schon getan hat: Bevor „The Tree of Life“ Mitte Mai in Cannes die Goldene Palme gewann, wurde der Film bei der Premiere zunächst ausgebuht. Und doch gelingt es MALICKs Leinwandsymphonie durchaus, den schönen und grausamen Makrokosmos mit dem Mikrokosmos der Zerrissenheiten des kleinen Jack in der texanischen Provinz zu parallelisieren. Denn der dynamische Antagonismus von „Natur“ und „Gnade“ wiederholt sich im Mikrokosmos der bürgerlichen und gottgefälligen Familie O’Brien aus dem mittleren Westen der USA (vermutlich Waco, Texas, MALICKs Heimatstadt) in den 1950er Jahren. Erinnerungsfetzen an diese Durchschnittsfamilie bilden den zweiten „Teil“ von MALICKs Film. Eine gutbürgerliche und gottgefällige Welt (man geht sonntags in die Kirche), und doch findet sich hier im Kleinen all das Schöne und Beängstigende, welches auch das ganz Große kennzeichnet. Da ist auf der einen Seite der Vater, Mr. O’Brien (bewusst zwiespältig gespielt von BRAD PITT), ein herrischer Sturkopf, dem es nicht gelungen ist, seine Ambitionen zu realisieren. Dereinst wollte er ein großer Musiker werden, war aber zu schwach dazu. Jetzt wäre er wenigstens gern erfolgreich und versucht, Erfindungen zu verkaufen. An seinen großen Erwartungen gescheitert und auf seine Durchschnittlichkeit zurückgeworfen, versucht er nun, mit einem Erziehungsregiment aus Zuckerbrot und vor allem Peitsche, seine drei Söhne auf die Härten des Lebens hin zu trainieren und zu „richtigen“, durchsetzungsfähigen Männern zu machen (und bewirkt am Ende doch nur, dass sie Angst vor ihm haben und an ihren eigenen Zerrissenheiten leiden). Und da ist auf der anderen Seite die Figur der Mutter (engelsgleich von JESSICA CHASTAIN in Szene gesetzt) – ganz die überreine „Gnade“ ist sie die verströmende Sanftmut selbst, die ihren Kindern das Gefühl der Barmherzigkeit und die Liebe zu allen Dinge mitgeben möchte. All das ist natürlich eine reichlich stereotype Aufteilung, gleichwohl erfüllt sie aber ihren Zweck: MALICKs beide Wege durchs Leben („Natur“ oder „Gnade“) auch in diesem alltäglichen Familien-Mikrokosmos zu illustrieren. Es ist vor allem der älteste Sohnes Jack(stes nachdenklich und widerspenstig gespielt von HUNTER MCCRACKEN), der mit dem Vater immer wieder aneinander gerät. Es gelingt Jack aber auch nicht, angesichts von Gewalt und beginnender Sexualität den überirdischen Harmonieidealen der Mutter gerecht zu werden. Und diese Zerrissenheit prägt Jack noch als er längst erwachsen ist (nun fast wortlos, aber einprägsam verkörpert von SEAN PENN). Es sind seine Gedankenfetzen, die der Film präsentiert, es sind seine Fragen an Gott und Kosmos, mit denen MALICK den Zuschauer konfrontiert. Zwar hat er sich mit seinem Vater versöhnt und ist äußerlich durchaus ein erfolgreicher Architekt, doch die grundsätzlichen und verwirrenden Fragen bleiben.
Der dritte „Teil“ des Films wendet sich dem erwachsenen Jack zu, hebt aber nach der überzeugenden Darstellung der Labilität von Jacks innerer Welt rasch ab: In einer Art von spiritueller Reise springt der Film ans Ende aller Zeiten, Jack vereinigt sich in surrealen Landschaften wieder mit Familie und Freunden und sogar sein toter Bruder wird wieder „auferweckt“. Wohlgemerkt geschieht all dies aber nur in seiner Vorstellungswelt. Doch dieser Vorgriff auf das eschatologische Ende aller Dinge dürfte in einem Film, in dem es schlichtweg um „alles“ gehen soll, vermutlich unumgänglich sein. Jedenfalls führt er dazu, dass Jack seinen inneren Frieden findet und der eiskalten Architektonik des 21. Jahrhunderts mit einem leisen Lächeln begegnen kann.
MALICKs Bilderflut gleicht eher einer Meditation als einem normalen Film (mit einer „richtigen“ Story). Die Szenen des Films bauen nicht konsequent aufeinander auf, es handelt sich um elliptische Impressionen. MALICKs Film hat keine richtige Geschichte, ist weniger Epos als vielmehr bebilderte Lyrik aus labyrinthischen Erinnerungsfetzen und Traumbildern. Man könnte auch sagen: MALICKs Opus ist eher ein Gebet als ein Film. So mancher wird genervt sein, wenn aus dem Off ständig die großen und bohrenden Fragen der menschlichen Existenz geflüstert werden und sich die Kamera immer wieder fragend gen Himmel wendet. Und auch das streckenweise etwas dick aufgetragene Musik-Sammelsurium wurde bereits als „unerträgliche Musiksoße“ (TERESA CORCEIRO) bezeichnet. Gleichwohl ist „The Tree of Life“ ein Film, der sich wohltuend vom sonstigen Action-Gewitter Hollywoods abhebt und versucht, den Dingen auf den Grund zu gehen. Und MALICK löst diesen Grund – zunächst – nicht in naiver Harmonie auf, sondern buchstabiert alles nach dem (schlichten) Muster der beiden Grundkonstellation von „Natur“ versus „Gnade“ durch – einer Grundkonstellation, die das Leben schenkt, es wieder zerreibt, es wieder schenkt und wieder zerreibt. Offenbar wurde in diesem Sinn auch der Titel gewählt. „The Tree of Life“ ruft zwei Bäume in Erinnerung: erstens den paradiesischen „Baum des Lebens“ aus der Bibel (das ist wohlgemerkt nicht der „Baum der Erkenntnis“, von dem ADAM und EVA nicht essen durften), und zweitens den Baum der Entwicklung des Lebens aus CHARLES DARWINs Evolutionstheorie. Die beiden Bäume entsprechen den beiden Grundkonstellation von „Natur“ und „Gnade“: da ist der „Weg der Natur“ (DARWINs Evolutionstheorie) auf der einen Seite und der „Weg der Gnade“ (den Weg der Liebe, möglicherweise Gottes Weg) auf der anderen. Beide Bäume oder Wege sind real, und auch der Mensch ist nur ein kleines verlorenes Blatt an diesen beiden Bäumen des Lebens. Philosophie oder Theologie à la MALICK beginnt mit der Weigerung, die Dinge in eine der beiden Richtung hin einfach aufzulösen.
Was soll man nun anfangen mit der Metaphysik von „The Tree of Life“? Einiges ist bereits geschrieben worden über die religiöse Einordnung von MALICKs Film. Ein Punkt ist die Behauptung, er vertrete einen „Pantheismus“ (MARTIN GOBBIN), sein Film sei daher „nicht mono-, sondern pantheistisch […], spirituell, aber nicht christlich“ (DANIEL BUND). Aber „pantheistisch“ ist MALICKs Film ganz sicher nicht. Legen wir einmal die übliche Dreiteilung zugrunde, um nicht durcheinander zu geraten: Da gibt es den „Pantheismus“ (Gott und Welt sind identisch; alle Dinge sind Gott), dann den traditionellen „Supranaturalismus“ (Gott ist das übernatürliche und allmächtige Wesen außerhalb der Welt, das aufgrund seiner umfassenden Vollkommenheit unveränderlich ist und aus der Welt nichts mehr gewinnen kann), und schließlich den „Panentheismus“ (Gott und Welt sind nicht identisch, aber auch nicht getrennt voneinander; Gott ist die „Seele des Universums“, die mit all ihren Potenzialen immer auch mehr ist als diese wirkliche Welt, und die Welt ist sein Körper – mit all dem Schönen, aber auch all den Wunden und Unvollkommenheiten). Wenn man diese Dreiteilung zugrundelegt, dann ist MALICKs Theologie sicher nicht pantheistisch (noch viel weniger als etwa die Religion in JAMES CAMERONs „Avatar“). Denn die Welt, die TERRENCE MALICK zeigt, ist alles andere als nur göttlich, sondern ebenso gekennzeichnet durch das Grausame, das Gleichgültige, das Schreckliche. Genau dies macht ja die religiöse Pointe von MALICKs Film aus: Die Welt ist „Gnade“ und „Natur“, ein Kuddelmuddel aus Schönem und Grausamem zugleich. MALICKs Film bewegt sich irgendwo zwischen Supranaturalismus und Panentheismus. Klar, JESUS VON NAZARETH kommt nicht (wirklich) vor, und insofern transportiert der Film nicht die eng gezäumte Mythologie des traditionellen christlichen Glaubenspakets. Und natürlich kann man mit BRAD PITT über TERRY MALICK sagen, seine „Vorstellung von Gott [entspreche] eher einer philosophischen Denkweise als der christlichen Religion“. Gleichwohl ist MALICKs Film spirituell und schlussendlich christlich. Denn seine Gottesvorstellung entspricht völlig dem normalen christlichen Monotheismus.
Die moderne Welt hat Gott verloren und sucht ihn. (Alfred North Whitehead)
Ein weiterer Punkt ist der, dass MALICK die großen Fragen stellt, sich aber den ganzen Film über mit Antworten zurückhält. Sein Opus ist nun mal keine metaphysische Abhandlung. In gewissem Sinn hat er wenig zu sagen (im Sinne von Erzählen oder Erklären), sondern stellt „nur“ Fragen. Es ist auch nicht das Geschäft eines Filmemachers, metaphysisch durchbuchstabierte Antworten zu geben. Am Ende aber versucht MALICK dann aber doch, eine Antwort auf die Widerstreite des Lebens zu geben – und scheitert grandios. Dies wird deutlich, wenn in der surrealen Szene am Schluss des Films Mrs. O’Brien ihren Sohn Gott überantwortet („Ich gebe Dir meinen Sohn.“) und Engelschöre dazu ein bestätigendes: „Amen!“ singen. Wie man es nun dreht oder wendet – an dieser Stelle scheitert der Film. Denn entweder liest man das einfach als psychologisches oder religiöses Loslassen angesichts eines unabänderlichen Schicksals (alles in den Gedanken des erwachsenen Jack), dann zerbricht der Film ästhetisch: Hatte er das Problem vorher in allumfassende kosmische Dimensionen erhoben, so gibt es jetzt doch nur die ganz kleine, private Lösung. Oder aber man nimmt diesen Schluss als grundsätzliche theologische Aussage, dann erliegt MALICK am Ende doch dem Drang, all den Geschehnissen einen tieferen göttlichen Sinn zu unterschieben, dem man sich hingeben sollte. Nicht seine duale Metaphysik ist daher das Problem (die gibt es in allen Religionen), sondern dass er sie am Ende auflöst und hinter all den offensichtlichen Sinnlosigkeiten doch das Wirken der einen geheimnisvollen Macht sieht, in der sich alles organisch aufhebt. Genau dies zeigt auch noch ein anderes Indiz: Über den gesamten Film hinweg wird Gott von den Offstimmen immer wieder gefragt: „Wo warst Du?“. Aber bereits in der allerersten Einstellung des Films, nämlich dem Hiob-Zitat, stellt Gott diese Frage an den zweifelnden Menschen: „Wo warst du, als ich die Erde gegründet? Sag es denn, wenn du Bescheid weißt.“ (Hiob 38,4). Von Anfang an vertraut MALICK also auf die verborgene Auflösung aller Dinge in der unerforschlichen Weisheit Gottes. Es ist genau dieser Punkt, an dem der Film theologisch grandios scheitert.
Gleichwohl ist MALICKs Opus unbedingt sehenswert. Große Fragen werden aufgeworfen. Und am Ende illustriert der Film eine Diagnose, die der Philosoph ALFRED NORTH WHITEHEAD unserer Zeit schon vor Jahrzehnten ausgestellt hat: „Die moderne Welt hat Gott verloren und sucht ihn.“







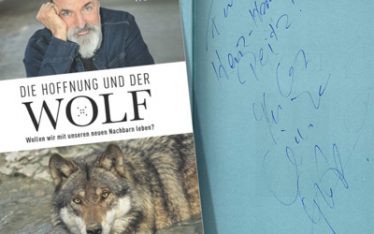

Recent Comments