 Den aktuellen Kontroversthemen zwischen Naturwissenschaften und Theologie tragen das Februar- und Märzheft der „Stimmen der Zeit“ mit vier Artikeln und drei Rezensionen Rechnung.
Den aktuellen Kontroversthemen zwischen Naturwissenschaften und Theologie tragen das Februar- und Märzheft der „Stimmen der Zeit“ mit vier Artikeln und drei Rezensionen Rechnung.
Rezensionen zu:
– U. Lüke, Das Säugetier von Gottes Gnaden, Freiburg 2006
– F. Schrenk, S. Müller, Die 101 wichtigsten Fragen: Urzeit, München 2006
– H. D. Mutschler, Physik und Religion, Darmstadt 2005
Brücken im Unüberbrückbaren
Christian Kummer (StdZ, 2008, H. 2, S. 87-100) rechnet in dem Beitrag Ein neuer Kulturkampf? Evolutionsbiologen in der Auseinandersetzung mit dem ‚christlichen Schöpfungsmythos‘ differenziert und kenntnisreich mit dem Kreationismus und der naturwissenschaftlichen Gegenoffensive gleichermaßen ab. Während der Kreationismus bereits hinreichend ausführlich der Kritik unterzogen wurde, blickt Kummer auf die neuen Artikulationen des Naturalismus, der sich in manchen seiner Vertreter den Vorwurf gefallen lassen muss, mit Weltanschauungsanspruch daher zu kommen. „Das bestätigt unsere Vermutung, der allseits als anerkennenswert erachtete Feldzug gegen den Kreationismus diene nur als willkommene Gelegenheit zu einer Generalabrechnung mit den Erscheinungsformen von Religion jedweder Couleur“ (96).
Am deutlichsten und militantesten tritt diese Strategie beim Evolutionsbiologen Richard Dawkins (Bestseller „Der Gotteswahn“) zu Tage, so dass Godehard Brüntrup (Atheismuswahn versus Gotteswahn, StdZ, 2008, H. 2, 130-134) feststellen muss, „daß der Religionskritiker Dawkins selbst zum ‚Hohenpriester‘ einer dialogunfähigen Religion geworden ist. Kaum einer ist darüber mehr erfreut als jene Vertreter der Religionen, die selbst das Projekt der Moderne ablehnen“ (130). Brüntrup empfiehlt gegen Dawkins die „ruhige, überlegte Antwort“ der Autoren McGrath, deren Buch „Der Atheismuswahn“ zeige, „daß diese wichtige Diskussion auf einem höheren Niveau geführt werden muß als jenem, auf dem sich Dawkins anscheinend wohlfühlt“ (134).
Darüber hinaus macht Thomas Schärtl deutlich, dass man sich „theologischerseits nicht so leicht aus der Verantwortung stehlen“ kann (StdZ, 2008, H. 3, 156). Es sei nämlich kein Zufall, „daß Dawkins als seine Gegner vor allem Kreationisten und Intelligent-Design-Theoretiker ausgemacht hat und den dort verbreiteten Gottesbegriff inkriminiert. Die theologische Verantwortung für den Gottesbegriff wird hier implizit eingeklagt.“ Gott sei oft allzu leichtfertig mit personalen und anthropomorphen Attributen popularisiert worden. Hilfreich sei eine Rückbesinnung auf den „größeren Gott“, wie Schärtl ihn in der Theologie Karl Rahners und seiner visionären, bis heute nicht ausgeschöpften, evolutiven Christologie erblickt. „Für die christlichen Kirchen sollte das Wiedererstarken des denunziatorischen Atheismus ein willkommener Anlaß sein, den Gottesbegriff endlich aus der Hand der fundamentalistischen Kleinkariertheit und Kleingläubigkeit zu entwinden und sich in Liturgie, Verkündigung und Katechese mutig auf die Seite des ‚je größeren Gottes‘ zu stellen“ (157).
Auch wenn die akademischen interdisziplinären Diskurse weitaus differenzierter geführt werden, als die polarisierende Debatte um Kreationismus und militantem Atheismus, so behält Ulrich Lükes Befund recht: „Wer nach Brücken im naturwissenschaftlich-theologischen Dialog sucht, findet derzeit auf beiden Uferseiten nur Brückenköpfe ins noch immer Unüberbrückbare“ (StdZ, 2008, H. 2, 138).








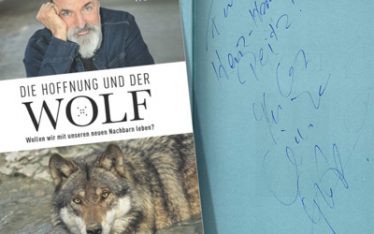

Recent Comments