In der renommierten Reihe „Religion, Theologie und Naturwissenschaft“ des Verlags Vandenhoeck & Ruprecht erscheint im September ein mächtiger Sammelband, der sich kritisch mit der deutschen Kreationismus- und Intelligent-Design-Szene auseinandersetzt:
„Evolution im Fadenkreuz des Kreationismus – Darwins religiöse Gegner und ihre Argumentation“, hg. v. Martin Neukamm.
Als Fazit sei vorweggenommen, dass das Buch für all diejenigen ein Muss darstellt, die sich intensiv mit deutschem Kreationismus und Intelligent Design, vor allem mit deren naturwissenschaftlicher Argumentation, auseinandersetzen wollen oder müssen.
Übrigens: Der Herausgeber hat eine eigene Website zum Buch eingerichtet.
Besprechung des „kritischen Lehrbuchs“ von R. Junker und S. Scherer
Komplexität des Themas und Zielgruppe
Da das Buch eine solche Auseinandersetzung nicht oberflächlich führen, sondern der Komplexität der Diskussionen Rechnung tragen will, stellt die „Lektüre mitunter hohe Ansprüche an den Leser“ (7), wie das Vorwort selbst einräumt. Das ist aber weniger Schwäche als Stärke des Buches. Denn wer einmal in dem evolutionskritischen Lehrbuch von Reinhard Junker und Siegfried Scherer blättert, wird von der v. a. naturwissenschaftlichen Detailfülle geradezu erschlagen und dankbar sein, auf ähnlicher Detailebene Gegenargumente ins Gespräch bringen zu können. Hier wird man in dem vorliegenden Sammelband fündig. Die Arbeit mit dem komplexen Thema und Stoff des Buches wird dabei durch Zusammenfassungen am Ende der Kapitel und durch ein ausführliches Glossar erleichtert. Außerdem gestattet die Publikation ein am eigenen Interesse orientiertes auszugsweises Lesen. Dadurch wird das Buch zu einer Fundgrube für wissenschaftlich interessierte Laien, aber auch für ein akademisch geschultes Publikum, das Detailarbeit nicht scheut, sondern für einen tragfähigen eigenen Standpunkt oder kontroverse Diskussionen geradezu sucht.
Ziel und Gegenstand des Sammelbandes
Im Buch werden „zentrale Aussagen prominenter Evolutionsgegner (schwerpunktmäßig aus dem deutschen Sprachraum) analysiert, wobei kein Anspruch auf Vollständigkeit erhoben wird“ (6). In der Tat ist die Palette der analysierten Gegner nicht sehr breit, dafür aber auf die wichtigsten Akteure konzentriert: International werden Michael Behe und William Dembski behandelt, aus dem deutschen Raum u. a. Wolf-Ekkehard Lönnig, vor allem aber Reinhard Junker und Siegfried Scherer. Das von Junker/Scherer herausgebrachte Buch „Evolution – ein kritisches Lehrbuch“ zieht sich wie ein roter Faden durch den hier zu besprechenden Band, und ist der am häufigsten zitierte Bezugspunkt – nicht nur in dem eigens diesem Lehrbuch gewidmeten Kapitel. Der Verzicht auf Vollständigkeit und die Konzentration auf wenige Autoren ermöglicht eine thematisch in die Breite und Tiefe gehende Analyse und ist in ihrer Auswahl gerechtfertigt: Das evolutionskritische Lehrbuch dürfte die bestgemachte und einflussreichste Kreationismus- bzw. ID-Publikation in Deutschland sein, ist Träger des (evangelikalen) Deutschen Schulbuchpreises 2002 und 2006 bereits in der sechsten Auflage erschienen. Außerdem enthält es alle gängigen Argumente der Evolutionskritik.
Thematische Schwerpunkte von einschlägigen Autoren
Die 14 thematischen Kapitel werden durch vier Teile gebündelt (geschichtliche und wissenschaftstheoretische Einführung, Inhalte evolutionskritischer Argumentation, Struktur evolutionskritischer Argumentation, Schlussbetrachtung), wobei mir manche Zuordnung nicht ganz plausibel erscheint. Kapitel XIII über das Begriffspaar „Mikro-/Makroevolution“ hätte im Anschluss an Kapitel VIII (Kritik an der „Makroevolution“) einen plausibleren Platz gefunden als in der Schlussbetrachtung nachzuklappen. Und die Kritik von Thomas Junker an Junker/Scherer beleuchtet mehr als nur die Struktur evolutionskritischer Argumentation, wie dies die Zuordnung zu Teil 3 nahelegt. Dies mag an der Schwierigkeit liegen, in sich schlüssige, und damit auch separat lesbare, Einzelbeiträge zu einem einheitlichen Ganzen zusammen zu komponieren. Während dies einer Monografie aus der Hand eines Autors besser gelingen kann, liegt der Vorteil des vorliegenden Sammelbandes in der speziellen Kompetenz der einzelnen, einschlägigen Autoren. So ist mit Christina Aus der Au, Andreas Beyer, Hansjörg Hemminger, Thomas Junker, Peter Michael Kaiser, Martin Neukamm, Stefan Schneckenburger und Johannes Sikorski die ganze Palette von der Chemie über Mikrobiologie und Evolutionsbiologie bis hin zur Theologie vertreten. Entsprechend kompetent wirken die Beiträge, von denen hier die Hauptgedanken der ID-Kritik vorgestellt werden sollen.
Teil I: Inhalte evolutionskritischer Argumentation
Irreduzierbare Komplexität – das Hauptargument
Martin Neukamm, Chemiker und Geschäftsführer der AG Evolutionsbiologie, widmet dem Hauptargument der ID-Protagonisten, der irreduzierbaren Komplexität (irreducible complexity, IC), ein eigenes Kapitel (VIII), wobei das Argument in konkreter Anwendung auch in anderen Kapiteln auftaucht. IC bezieht sich auf komplexe Systeme, die nur durch das Zusammenspiel ihrer Einzelkomponenten funktionsfähig sind und deshalb vermeintlich nicht schrittweise evolutiv aufgebaut werden können. Da funktionslos fielen diese Zwischenstadien der Selektion zum Opfer. Also müsse das gesamte System mit einem Mal direkt entstehen. Das Auftreten der hierfür notwendigen Anzahl gleichzeitiger, passender Mutationen ist aber beliebig unwahrscheinlich.
Als Entgegnung beschreitet Neukamm einen Modellweg, der aufzeigen soll, dass der Funktionswandel durchaus über eine kontinuierliche Folge von Mutationen verlaufen kann, wenn „zumindest kurzfristig eine zeitliche Überlappung der früheren und der späteren Funktion“ (214) auftritt. Das ist der Fall wenn Elemente eine Doppelfunktion erfüllen, die damit zur Brückenfunktion wird. „Die Suche nach den entsprechenden Brückenfunktionen ist ein wesentlicher heuristischer Aspekt bei der Auflegung neuer Forschungsprogramme“ (215). Wenn es also gelingt, die neue irreduzierbare Funktion als Nebenprodukt von evolutiven Optimierungsvorgängen zu beschreiben, ist dem IC-Argument der Boden entzogen (216f.).
An verschiedenen Beispielen führt Neukamm die Gangbarkeit dieses Modellweges vor und setzt sich auch mit Gegenargumenten auseinander.
Standard-Beispiel: Flagellum
Neukamm wendet diesen Weg in direkter Entgegnung zu Junker/Scherer (J/S 2006, 155-163) am bekannten Beispiel des Flagellensystems von Bakterien an (83ff.), ein Beispiel, das später von Johannes Sikorski in aller Ausführlichkeit (262-301) diskutiert wird. Zusammengefasst dreht sich der Dissens zwischen Junker/Scherer und Neukamm/Sikorski um die Frage, wie viele Aminosäuren gleichzeitig ausgetauscht werden müssen, um eine rotierende Flagelle zu erzeugen.
Junker/Scherer kommen zu dem Schluss, „dass der Umbau von präadaptierten Motorproteinen durch die zufällige Entstehung aller notwendigen Mutationen zu einem Zeitpunkt in einer Zelle mit derart niedriger Wahrscheinlichkeit abläuft, dass dieses Ereignis selbst in erdgeschichtlichen Zeiträumen nicht zu erwarten ist“ (J/S 2006, 162). Diese Wahrscheinlichkeitsabschätzung wird von Neukamm/Sikorski als unrealistisch verworfen. Dazu stellt Sikorski drei logisch denkbare Entstehungsszenarien von Flagellen vor (274f.), wobei Szenario 1 „in der wissenschaftlichen Welt so gut wie nicht vertreten“ werde (274). Ausgerechnet dieses Szenario aber läge der Argumentation von Junker/Scherer zugrunde: „J/S präsentieren also ein Evolutionsmodell, welches unter Flagellen-Evolutionsforschern keinen Rückhalt findet, kritisieren dieses als unwahrscheinlich und bauen dadurch ein sachlich unkorrektes Argument gegen die Flagellenevolution auf“ (284). Das zweite Gegenargument betrifft die Möglichkeit eines langsamen Umbaus über Zwischenstufen. Junker/Scherer sehen hier Grenzen: „Zwei Basisfunktionszustände sind dadurch definiert, dass der postulierte evolutive Übergang zwischen ihnen nicht mehr in weitere selektionspositive Zwischenstufen unterteilt werden kann“ (J/S 2006, 158). Die Kluft zwischen zwei Basisfunktionszuständen schätzen Junker/Scherer so groß ein, dass ein langsamer Umbau Richtung des zweiten Zustands nicht möglich, da schädlich ist (wie sie auch an anderer Stelle schreiben (J/S 2006, 154), auf die sich Sikorski bezieht (295)). Nach Sikorski gibt es jedoch „genügend Beispiele …, dass der ‚langsame Umbau‘ keineswegs schädlich sein muss, sondern neue funktionelle Varianten tatsächlich hervorbringen kann“ (285). Ferner passten die bei Junker/Scherer auf S. 160f. „zitierten Forschungsarbeiten gar nicht in den diskutierten Kontext“ (285).
Dies zu beurteilen, bleibt Fachleuten vorbehalten. Als Laie ist mir aber nicht entgangen, dass Nicholas Matzke ein hypothetisches Szenario des soeben diskutierten ‚langsamen Umbaus‘ erarbeitet und wirksam verbreitet hat (in Internet und Youtube leicht zu finden).
Im vorliegenden Buch wird dieses Szenario mehrfach erwähnt (86, 278) und vom Mikrobiologen Sikorski als „beeindruckendes und belastbares Modell zur Evolution des bakteriellen Flagellensystems“ wertgeschätzt. Schon jetzt wird dieses stammesgeschichtliche Modell vom sehr ähnlichen individualgeschichtlichen Aufbauprozess einer Flagelle unterstützt (282f.). Inwieweit es künftigen Belastungen tatsächlich standhalten wird, erweist sich abermals im Fachdiskurs, aber mich wundert es mit Sikorski (290) schon, dass dieses Modell bei Junker/Scherer überhaupt nicht erwähnt, geschweige denn diskutiert wird.
Es ist erwähnenswert, dass Scherer in einer jüngeren Veröffentlichung auf das oben auch in der populären Youtube-Variante gezeigte Matzke-Modell ausführlich eingeht (Scherer, Makroevolution molekularer Maschinen, in: Hahn u.a. (Hg.): Atheistischer und jüdisch-christlicher Glaube : Wie wird Naturwissenschaft geprägt, Books On Demand 2009, 93-146). Bei aller Wertschätzung ist Matzkes Modell für Scherer aber immer noch keine hinreichende Erklärung, sondern „evolutionäres story telling“ (Scherer 2009, 93, 116): „Das von Matzke entworfene Szenario ist eine phantasievolle Geschichte (das ist keineswegs abwertend gemeint, jede Naturwissenschaft lebt von kreativen Hypothesen …). Sie beruht auf dem gedanklichen Postulat vieler selektionspositiver Zwischenstufen auf einem hypothetischen Evolutionsweg (kumulative Selektion)“ (Scherer 2009, 117). Dass eine solche Zwischenstufe positiv von der Selektion bewertet werden kann, ist für Scherer jedoch „eine zwar notwendige, keinesfalls aber eine hinreichende Bedingung dafür, dass sie durch Evolution entstehen kann“ (ebd.).
Immerhin – so könnte man an dieser Stelle einwenden – ist das Zugeständnis, dass selektionspositive Zwischenstufen als denkbar anerkannt werden, schon mehr als das Bestreiten solcher Zwischenstufen beim Argument irreduzierbarer Komplexität (wie noch bei J/S 2006, 157ff.). Damit erhöht sich die Entstehungswahrscheinlichkeit ggf. drastisch(s.u.).
Der Hinweis auf story telling ist für Scherer keine „Killerphrase“, die weiter unten als Fehlform begegnet, sondern heuristisches Mittel: „Es ist das Verdienst von Matzke, ein spekulatives Szenario zur Evolution des Bakterienmotors vorgeschlagen zu haben. In diesem Szenario wird eine Evolutionsgeschichte erzählt, die gut geeignet ist, um zunächst einmal theoretisch geprüft zu werden“ (Scherer 2009, 116). Scherer unterwirft nun die „Geschichte“ einem „reality check“ (ebd. 117), indem er von den 11 postulierten Evolutionsschritten exemplarisch den 4. Schritt soweit zu operationalisieren sucht, dass eine datengestützte Abschätzung möglich wird. Dabei kommt er zunächst zu 9 gleichzeitig notwendigen Mutationen. Wenn es dabei bliebe, wäre dies eine drastische Reduzierung gegenüber den im kritischen Lehrbuch angenommenen 160 gleichzeitigen Mutationen (J/S 2006, 162) und damit eine ebenso drastische Erhöhung der Entstehungswahrscheinlichkeit. Zu den quantifizierbaren Mutationsschritten gesellen sich jedoch zwei Fragezeichen, die folgende Alternative zulassen:
1. Die Fragezeichen verbleiben bei aller Unbestimmtheit in der Dimension der übrigen Mutationszahlen; dann gilt die drastische Erhöhung der Entstehungswahrscheinlichkeit.
2. Die Fragezeichen sind als Asylum ignorantiae, als Zufluchtsort der Unwissenheit, der Platzhalter für willkürlich hohe Mutationszahlen. Nur dann wäre Scherers Schluss, „dass die Gesamtwahrscheinlichkeit für den betrachteten Evolutionsschritt sehr, sehr klein ist“ (Scherer 2009, 128), verständlich. Dann aber ist dieser Schluss ebenso willkürlich, ein Schluss aus Nichtwissen, die Fehlform des Argumentum ad ignorantiam (siehe unten).
Scherers Aussage, „die Behauptung, die Evolution des Bakterienmotors sei grundsätzlich geklärt, ist meines Erachtens nicht durch naturwissenschaftliche Daten gedeckt“ (ebd. 129), mag zwar im Blick auf so manche Fragezeichen richtig sein, sagt aber nach dem soeben Ausgeführten letztlich nichts über die tatsächliche Entstehungswahrscheinlichkeit.
Außerdem: Erwartet Scherer von einer naturwissenschaftlichen Erklärung zu viel? Nach Martin Neukamm kann „aus naturwissenschaftlicher Sicht … eine Erklärung nie etwas anderes sein als die modellhafte Beschreibung eines Prozesses, eine wohlbegründete ‚Geschichte‘ darüber, was die Welt zusammenhält, wie sie sich entwickelt hat und nach welchen Mechanismen die betreffenden Vorgänge ablaufen. … Dabei wird nicht der Anspruch erhoben, tatsächlich bewiesen zu haben, dass die Erklärung die Realität in allen Punkten korrekt und vollständig repräsentiert“ (218).
Wie auch immer die Wahrscheinlichkeiten auf naturwissenschaftlicher Ebene zu beurteilen sind,Scherer schließt methodisch jedenfalls nicht von der – seiner Meinung nach – derzeitigen Unerklärtheit auf eine grundsätzliche Unerklärbarkeit, die deshalb einen Designer erforderlich mache: „Das Äußerste, was man als Biologe begründet behaupten kann, [ist] die zum gegenwärtigen Zeitpunkt zu statuierende ‚Nicht-Erklärtheit‘ der Entstehung einer biologischen Struktur“ (Scherer 2009, 134).
Beispiel Aronstab
Der Botaniker Schneckenburger ananlysiert das von Junker/Scherer (J/S 2006, 79-82) angeführte Beispiel des Aronstabs, an dessen Blütenstand Junker/Scherer die IC-Argumentation exemplarisch durchführen – mit dem Schluss: „Ein Selektionsvorteil ist nur im fertig ausgebildeten Zustand gegeben; ‚unfertige‘ Zwischenstufen sind biologisch wertlos und werden durch stabilisierende Selektion ausgemerzt“ (J/S 2006, 80). Schneckenburger stellt nun verblüffenderweise fest, „dass (über die gesamte Familie verteilt) die zu erwartenden Zwischenstufen im Sinne einer Merkmalsphylogenie nahezu lückenlos zu finden sind und ganz offensichtlich auch funktionieren“ (255). Wenn das, was in der heutigen Familie positiv bewertet wird, auch in der evolutiven Entwicklung positiv bewertet werden und als Zwischenschritt vorkommen konnte, dann musste der Blütenstand des Aronstabs gar nicht „auf einmal“ in einem „Riesenschritt“ aus einem einfachen Laubblatt entstehen, wie die Abbildung bei Junker/Scherer (J/S 2006, 80) suggeriert. Schneckenburger: „Nichts Empirisches spricht für einen unüberbrückbaren evolutionären Graben oder für ein plötzliches Auftauchen neuer Strukturen“ (255).
Beispiel Wasserschlauch Utricularia
Bei der Saugfalle des Wasserschlauchs Utricularia läuft Neukamms Argumentation auf dasselbe Schema hinaus, nämlich auf die Widerlegung der IC-These, dass alle Einzelkomponenten der Saugfalle simultan in einem gigantischen Schritt evolvieren mussten. Erwähnt sei dies Beispiel deshalb, weil sich die Diskussion diesmal auf Wolf-Ekkehard Lönnig bezieht, neben Junker/Scherer der bekannteste ID-Vertreter in Deutschland.
Fazit zur Irreduzierbaren Komplexität
In der innerwissenschaftlichen Diskussion geht es allen Beispielen um den Nachweis, dass eine als „irreduzibel komplex“ gekennzeichnete Struktur nicht „auf einmal in einem Riesenschritt“ entstehen musste, sondern über selektionspositive Zwischenschritte kontinuierlich erreicht werden konnte.
Der Vorteil des Sammelbandes ist, dass dieser Nachweis nicht nur behauptet oder an Analogien (Mausefalle) plausibel gemacht, sondern an realen biologischen Strukturen durchbuchstabiert wird.
Teil II: Struktur evolutionskritischer Argumentati
Untersucht man evolutionskritische Ausführungen, stößt man auf eine Reihe argumentativer Stilfiguren. Martin Neukamm hat nicht weniger als 14 „Populäre Fehlschlüsse und rhetorische Stilmittel“ mit Beispielen zusammen gestellt (305-320). Einige Stilmittel sind weit verbreitet und nicht auf den evolutionskritischen Kontext beschränkt (z. B. „Beeindrucken durch Fachsprache“, „Appell an Emotionen“, „Autoritätsbeweis“), andere wiederum sind gerade in der Auseinandersetzung mit Kreationismus und Intelligent Design typisch und zentral, wie der Fehlschluss des argumentum ad ignorantiam und der unzulässige Analogieschluss.
Argumentum ad ignorantiam
Wenn man ein Argument gegen eine Theorie (hier: die Evolutionstheorie) aus mangelndem Wissen bezieht (hier: wir wissen nicht, wie eine komplexe Struktur natürlich entstanden ist), bedient man sich eines logischen Fehlschlusses, der ohne Sachargumente gezogen wird. Denn wie kann ein Nichtwissen ein hinreichender Grund zur Widerlegung einer Theorie sein? (Siehe dazu oben die Diskussion um Scherer 2009)
Völlig zu Recht folgt für Neukamm „aus der Tatsache, dass es offene Fragen in der Evolutionsbiologie gibt, keinesfalls, dass die Bemühungen um ausschließlich natürliche Erklärungen fehlgeschlagen sind“ (306). Offene Fragen gehören zum Wesen von Wissenschaft überhaupt, und ohne offene Fragen wären die Evolutionsbiologen arbeitslos. Offene Fragen sind Anlass zu weiterer Forschung, und man kann sie lediglich als momentanes (!) Nichtwissen klassifizieren. Hier hätte Neukamm noch stärker mit Bernulf Kanitscheider argumentieren können (siehe den Beitrag Ignoramus – Ignorabimus). Denn der Fehlschluss, der im Kontext von Kreationismus und ID immer wieder begegnet, ist der Umschlag vom momentanen Nichtwissen zum Grundsätzlich nicht Wissbaren, vom momentan nicht Erklärten zum grundsätzlich Unerklärbaren: der Fehlschluss vom Ignoramus (wir wissen es nicht) zum Ignorabimus (wir werden es nicht wissen).
An dieser Stelle könnte man noch herausstellen (was aber nicht die Aufgabe von Herrn Neukamm sein muss), dass Intelligent Design nicht nur schlechte Naturwissenschaft, sondern auch schlechte Theologie ist. Denn wenn das beschworene Nichtwissen durch ID, letztlich also durch Gott, ersetzt wird, ist dies nichts anderes als ein Lückenbüßer-Gott. Ein solcher Gott – da hat sogar Dawkins Recht – ist in der Tat zum Tode verurteilt. Denn ist eine Erklärungslücke ein Argument für Gott, dann ist das spätere Erklären dieser Lücke zwangsläufig ein Argument gegen Gott. Ganz zu Recht beschreibt Christiana Aus der Au in ihrem späteren Beitrag die Einführung eines solchen Lückenbüßer-Gottes als Kategorienfehler (345).
Mit der Ablehnung dieser Fehlform rennt man übrigens bei Siegfried Scherer offene Türen ein. Scherer macht nicht vorschnell den Sprung vom Ignoramus zum Ignorabimus, eine Haltung, die die Gefahr berge, „auf Wissen zu verzichten, wenn sie dazu führt, dass die Erforschung des Problems deshalb aufgegeben wird, weil man es für unlösbar hält“ (in: „Intelligent Design“ ist keine naturwissenschaftliche Alternative zu biologischen Evolutionstheorien, S. 9). Und: „Wer bei Vorliegen von „Nicht-Erklärtheit“ auf „Nicht-Erklärbarkeit“ einer biologischen Struktur schließt, formuliert m.E. einen Glaubenssatz“ (ebd.). Theologisch schließt er an: „Außerdem besteht die Gefahr …, dass ein Designer als Lückenbüßer dort eingesetzt wird, wo die derzeitige Wissenschaft (noch?) keine Erklärung hat“ (ebd.).
Analogieschluss
Genauso häufig und z. T. in Verbindung mit dem Argumentum ad ignorantiam wirbt der Analogieschluss für die Plausibilität von ID. Seine Überzeugungskraft bezieht der Analogieschluss aus dem intuitiven Alltagsdenken, wie dies seinerzeit William Paley mit seinem Uhrenbeispiel unternommen hat: „The inference, we think, is inevitable, that the watch must have had a maker“. Auch heute noch, 200 Jahre nach Paley und 13 Jahre nach Dawkins‘ „The blind watchmaker“, werden biologische Objekte mit technischen Artefakten verglichen – nach dem Motto, das Neukamm vom Kreationisten Reinhard Junker bezieht: „Wenn schon vergleichsweise einfache synorganisierte technische Systeme bekanntermaßen [Appell an die Alltagserfahrung; HHP; Hervorhebung von Junker] nur durch Designer entstehen, dann gilt dies erst recht für die viel komplizierteren Lebensstrukturen“ (307).
Anschauungsmaterial hätte Neukamm auch das „kritische Lehrbuch“ geliefert (J/S 2006, 308), wo in einer Tabelle Artefakte und Organismen verglichen und das Argumentum ad ignorantiam mit dem Analogieschluss verbunden werden: Ausdrücklich wird dort der Faktor „unbekannt“ über den „Analogieschluss“ durch einen „Urheber“ ersetzt.

Gegenüberstellung von Artefakten und Organismen. Aus S/R 2006, 308; Wiedergabe mit freundlicher Genehmigung der Autoren. In der dortigen Legende heißt es: Aufgrund vergleichbarer Eigenschaften ist ein Analogieschluss auf die Entstehungsweise der Organismen möglich. Anmerkungen: (1) In der SETI-Forschung („Search for Extra-Terrestrial Intelligence“) ist die Handlungsweise der Urheber ebenfalls unbekannt. (2) Die experimentelle Biogenese-Forschung zeigte bisher, dass nur unter Einsatz von Design Makromoleküle des Lebens erzeugt werden können … (3) Irreduzible Komplexität muss in einer einzigen Generation entstehen. Damit ist der Vergleich Artefakte-Organismen hier zutreffend. (4) Heutige Lebewesen entstehen (soweit empirisch nachweisbar) durch Information von innen (Erbgut, Eigenschaften des Cytoplasmas u.a.). Doch dies ist für den Vergleich „Artefakte-Organismen“ irrelevant, da es um die erstmalige Entstehung geht, als Information von „innen“ noch nicht vorhanden war. (5) Auf diese Gemeinsamkeiten kommt es im Analogieschluss an.
Besserwisser-Killerphrasen
Unter anderem subsummiert Neukamm hier den Vorwurf des ‚evolutionären storytelling‘: „So ist es in der Evolutionskritik gang und gäbe, evolutionäre Modelle damit zu kontern, es handele sich dabei lediglich um phantasievolle Geschichten (’storytelling‘), um sie als wissenschaftliche Erklärung zu entwerten“ (319). Bis in die Wortwahl hinein haben wir diese Argumentationsfigur oben bei Scherer kennen gelernt. Zur Fehlform wird die Figur aber erst dann, „wenn Sachargumente fehlen“ (319). Diesen Vorwurf kann man Scherer, der von Neukamm an dieser Stelle übrigens auch gar nicht erwähnt wird, im obigen Beispiel des Flagellum sicher nicht machen.
Rosinenpickerei
Was mir in der Liste der rhetorischen Stilfiguren noch fehlt, ist die Rosinenpickerei, akademischer ausgedrückt: das eklektizistische Benutzen von Argumenten. So werden gern diejenigen Phänomene herausgegriffen, über deren Erklärung kein wissenschaftlicher Konsens besteht, oder die man für die eigene Argumentation (missbräuchlich) vereinnahmen kann.
Ein aktuelles Beispiel habe ich kürzlich in der Presseschau vorgestellt: die Vereinnahmung des von Stephen Jay Gould beschriebenen Phänomens der „Stasis“ und des plötzlichen Auftretens neuer Arten als Argument gegen Evolution durch den Vorsitzenden des texanischen Bildungsausschusses. Richard Dawkins –nicht gerade ein Freund des Gouldschen Ansatzes – ergreift aber gegenüber den Kreationisten für Gould Partei: „Eldredge und Gould sind zu Recht verärgert über den Mißbrauch ihrer Ideen durch die Kreationisten … Gould meint dazu: ‚Seit wir das unterbrochene Gleichgewicht als Erklärung für Trends vorgeschlagen haben, macht es mich wütend, wenn ich immer und immer wieder … so zitiert werde, als hätte ich eingeräumt, daß es in den Fossilfunden keine Übergangsformen gäbe.'“ (Gipfel des Unwahrscheinlichen, Reinbek : Rowohlt, Neuausgabe 2008, 121).
Auch zu dieser Stilfigur räumt Scherer gern ein: „Die im Kreationismus nicht seltene, in manchen Kreisen sogar häufige Ausblendung ‚unpassender’ Daten bei dem Versuch, ein bestimmtes Verständnis von der Geschichte des Universums, der Erde und des Lebens zu begründen, trägt mitunter ideologische Züge und ist konträr zu einer wissenschaftlichen Arbeitsweise.“ (Quelle).
Unter „Struktur evolutionskritischer Argumentation“ findet sich nun noch eine ausdrückliche Besprechung des evolutionskritischen Lehrbuchs von Junker/Scherer, die weit über strukturelle Aspekte hinausgeht. Darum verdient diese Besprechung einen eigenen Punkt.
Besprechung des „kritischen Lehrbuchs“
 Der Biologiehistoriker Thomas Junker wundert sich bereits im ersten Abschnitt seiner Rezension des „kritischen Lehrbuchs“ aus der Feder seines Namensvetters Reinhard Junker und des Koautors Siegfried Scherer, wie und warum jemand ein „Lehrbuch der Evolution verfassen [würde], der glaubt, dass es die Evolution der Organismen, die allmähliche Veränderung und Aufspaltung der biologischen Arten über lange Zeiträume, gar nicht gibt“ (321). Die Antwort seiner Analyse wird sein, dass die Autoren in Wirklichkeit gar kein Lehrbuch geschrieben haben, sondern „durch tendenziöse Auswahl, systematische Verzerrungen, Fehlinformationen und Sinnentstellungen“ beabsichtigen, „die Evolutionsbiologie zu diskreditieren, indem sie eine Karikatur ihrer Methoden und Ergebnisse zeichnen“. Eine „systematische Desinformation“ also, unter „Verleugnung der eigenen Standpunkte“ (337). Wie kommt Thomas Junker zu diesem Urteil und wie berechtigt ist es?
Der Biologiehistoriker Thomas Junker wundert sich bereits im ersten Abschnitt seiner Rezension des „kritischen Lehrbuchs“ aus der Feder seines Namensvetters Reinhard Junker und des Koautors Siegfried Scherer, wie und warum jemand ein „Lehrbuch der Evolution verfassen [würde], der glaubt, dass es die Evolution der Organismen, die allmähliche Veränderung und Aufspaltung der biologischen Arten über lange Zeiträume, gar nicht gibt“ (321). Die Antwort seiner Analyse wird sein, dass die Autoren in Wirklichkeit gar kein Lehrbuch geschrieben haben, sondern „durch tendenziöse Auswahl, systematische Verzerrungen, Fehlinformationen und Sinnentstellungen“ beabsichtigen, „die Evolutionsbiologie zu diskreditieren, indem sie eine Karikatur ihrer Methoden und Ergebnisse zeichnen“. Eine „systematische Desinformation“ also, unter „Verleugnung der eigenen Standpunkte“ (337). Wie kommt Thomas Junker zu diesem Urteil und wie berechtigt ist es?
Die Antwort und eine Gesamtwürdigung des Sammelbandes lesen Sie nächste Woche:
[weiter zum zweiten Teil der Besprechung]
Ihr Kommentar
04.12.2009 Wolfgang Jähnig
R. Junker: Ihr Satz im vorhergehenden Kommentar: Es braucht Forschung und die ist ergebnisoffen. – Mein Satz: Es braucht die Bibel um Fehldeutungen zu konstruieren und die sind nicht ergebnisoffen.
03.12.2009 Reinhard Junker
@M. Neukamm: Die 160 Mutationen lagen einem bestimmten Modell zugrunde und waren in diesem Modell somit nachvollziehbar. Dass dieses Modell durch ein besseres ersetzt wurde, hatte ich schon gesagt. Da dieses nicht Teil der fachwissenschaftliche Literatur ist, kann man so was ja mal übersehen. Aber Ihre Behauptung: „Nicht einmal 10 simultane Mutationen je Einzelschritt“ müssen Sie erst zeigen! Die Abschätzung von Herrn Scherer hat für den einfachsten (!) Schritt ca. 10 Mutationen im Minimum bei _evolutionsfreundlichen_ Annahmen ausgewiesen. Weitere Forschung kann zeigen, ob die 10 zu hoch oder zu tief (!) gegriffen ist. Deshalb braucht der Design-Ansatz Forschung. Wir erwarten, dass man zeigen kann, dass die Zahl 10 eher zu tief gegriffen ist, aber vielleicht stellt es sich anders heraus. In jedem Fall braucht es Forschung und die ist ergebnisoffen. Das ist entscheidend. „Design-Ansatz = Forschungskiller“ stimmt nicht. Erklärungsmodelle sind als notwendig, um prüfen zu können, ob ein evolutiver Weg möglich ist. An den Modellen sind wir also interessiert, aber wir setzen sie nicht ungeprüft mit „Nachweis eines evolutiven Entstehungsmöglichkeit“ gleich.
21.11.2009 Wolfgang Jähnig
Ein grundlegendes Mißverständnis (2. Teil) Die Bibel ist zur Deutung von Naturvorgängen überfordert, weil sie kein Naturkundebuch ist. Insofern müssen die verqueren Deutungen eines Zurechtstutzens der Schöpfung auf einige wenige Schöpfungstage mit einem Zeitraum von ca. 10 000 Jahren Weltexistenz bzw. 6 000 Jahren Menschheitsexistenz an der Wirklichkeit zerbrechen. Gott läßt uns an der Vergangenheit der Schöpfung teilhaben. Immer bessere technische Innovationen (terrestrische und weltraumgestützte Teleskope, Teilchenbeschleuniger, Supercomputer) sind die Voraussetzung, dass wir immer tiefere Einblicke in die Vergangenheit des Kosmos bekommen. Allein hier wird der Kurzzeit-Kreationismus ad abdurdum geführt. Schwieriger ist die Widerlegung auf dem Geb iet der belebten Natur. Der vorliegende Sammelband zum Darwin-Gedenkjahr ist einerseits notwendig, weil er in dieser Informationsdichte kreationistische Denkmodelle kritisch hinterfragt. Andererseits führen diese Auseinandersetzungen mit immer komplizierteren Denkmodellen zwangsläufig in eine Sackgasse zu einem Nullsummenspiel . Wir sind in einem Zwischenschritt von einem animalischen Bewußtsein zu einem kosmischen Bewußtsein. Der Kreationismus befindet sich in Deutschland in einer Randposition. Eine Spaltung der Gesellschaft ist für die nahe Zukunft nicht erkennbar und amerikanische Verhältnisse mit einem Gezerre vor Greichten wünscht sich hierzulande wohl niemand.
21.11.2009 Wolfgang Jähnig
Ein grundlegendes Mißverständnis (1. Teil) Die Anhänger einer kreationistischen Position behaupten, Gott habe zuerst eine vollkommene, heile Welt erschaffen. Wenn dem tatsächlich so wäre, dann gebe es uns nicht. Die Naturgesetze tragen Gottes Handschrift. Hatte Gott hier eine andere Wahl ? Jede noch so kleinste Änderung hätte eine andere Welt erschaffen, wenn nicht vom Urbeginn der Schöpfung an, Geburt und Tod, Werden und Vergehen Hand in Hand gehen würden. Erst die kosmische und biologische Evolution mit all ihren Grausamkeiten (vom menschlichen Standpunkt aus betrachtet ein Fressen und Gefressenwerden; schwarze Löcher verschlingen Sonnen, Lebewesen fügen anderen Lebewesen Leid zu usw.) führte zu einer Höherentwicklung, und es ist ein Glücksfall, dass wir existieren. An der Zeitdauer und dem Wie der Schöpfung scheiden sich die Geister. Die Schöpfung ist aber nicht abgeschlossen. Neue Sterne und Welten entstehen und vergehen immer noch.
08.11.2009 Wolfgang Jähnig
Im Beitrag von T. Junker (S. 335) wird die Frage gestellt, ob dem Biologielehrbuch noch ein evolutionskritisches Lehrbuch der Geologie folgen könnte. R. Junker hat auf Anfrage bestätigt, daß ein solches Lehrbuch bei W+W gegenwärtig nicht erscheinen wird. Die bisherigen Ansätze biblisch motivierter Geologen bei W+W (M. Stephan, Chr. Heilig) sind weit davon entfernt, ein ganzheitliches Geologie-Modell zu konzipieren, das mit der biblischen Schilderung vereinbar ist und gleichzeitig den aktuellen geologischen Wissensstand der etablierten Geologie integriert. Analog den biologischen Grundtypen als Schöpfungseinheiten wird über geologisch nicht überlieferte Lebensräume nachgedacht. Außerdem hat J. Scheven, ein pensionierter Gymnasialleher, versucht, ein biblisch motiviertes Standardwerk der Geologie zu entwerfen (Sehen lernen wo der Erdboden aufgedeckt ist – Vor uns die Sintflut – Stationen biblischer Erdgeschichte – Eine Kritik der aktualistischen Geologie; Kuratorium Lebendige Vorwelt, Hofheim a.T, 2007). Dieses üppig aufgemachte Buch mit Hochglanzpapier im Breitformat (230 Seiten) und einer Fülle von Abbildungen ist nicht offiziell im Buchhandel erhältlich, wurde jedoch 2007 an viele Schulen, Behörden, Museen usw. kostenlos verschickt. H. Pritschet (Gymnasiallehrer für Mathematik und Geographie) hat dieses Buch kritisch hinterfragt (www.transvesting.de/waswaere.htm). Der Beitrag von Pritschet dürfte kaum bekannt sein, da er ihn in einem Satireprogramm versteckte. Abschließend ein Zitat, das die verquere Denkweise von Kreationisten widerspiegelt: Sollte Gott die Flut in ausschließlich wunderhafter Weise bewirkt haben, wären unter Umständen keine Über-reste der Sintflut in Form von Schichtgesteinen und Fossilien zu erwarten, d.h., die Flut hinterließ möglicherweise keine erforschbaren Spuren. Denn man kann nicht ohne weiteres voraussetzen, daß Gottes Wunderhandeln erforschbare Objekte hinterläßt. (M. Stephan: Warum vertritt WORT UND WISSEN eine biblische Kurzzeit-Erdgeschichte , aber kein geologisches Sintflut-Modell ?; W+W Diskussionsbeitrag 2/03).
04.11.2009 Wolfgang Jähnig
R.Junker: Ihre glaubensmäßigen Überzeugungen müssen Sie nicht jedes Mal in einer Publikation bekennen. Aber Sie verhalten sich wie eine Amöbe, wenn Sie zwischen Kurz- und Langzeitkreationismus lavieren. Deutungen darf man nicht absolut setzen. Und genau das tun Sie. Können Sie sich vorstellen, daß Gott mit den Menschen durch die Geschichte und die in ihr gewachsenen Erkenntnisse hindurch mitgegangen ist? Siehe hierzu auch das soeben erschienene Buch des emeritierten Theologieprofessors Klaus-Peter Jörns: Mehr Leben bitte !, Gütersloher Verlagshaus 2009.
03.11.2009 Martin Neukamm
Muss ich meine _glaubensmäßigen_ Überzeugungen in einem Lehrbuch, das sich kritisch mit Evolutionstheorien auseinandersetzt, bekennen? —- Selbstverständlich, sofern Ihre Alternativen den Rahmen einer naturwissenschaftlichen Erklärung verlassen. Die Überzeugung eines Naturwissenschaftlers, der für alles, was einer Erklärung bedarf, ein Erklärungsmodell vorschlägt, ist ja per se naturalistisch. Das ist bei W+W in vielen zentralen Bereichen nicht der Fall. Aber darum ging es in meinem Kommentar gar nicht. Der Punkt ist, dass Ihre Abschätzung einer Wahrscheinlichkeit nachgewießenermaßen dem Prinzip garbage in, garbage out funktioniert. Die 160 Mutationen waren bereits vor Drucklegung Ihres Lehrbuchs weder theoretisch noch empirisch nachvollziehbar. Dabei muss der Naturwissenschaftler gar nicht lange suchen, um eine plausible Erklärung der Evolution des Flagellenapparats auf der Hand zu haben, die keine 160 Simultanmutationen (ja, nicht einmal 10 simultane Mutationen je Einzelschritt) postulieren muss. Wenn das kein Beleg für die (von Ihnen immer gerne bestrittene) Behauptung ist, dass W+W an Erklärungsmodellen, die uns ein kausales Verständnis der Entstehung molekularer Maschinen ermöglichen, nicht interessiert ist… (Dass hier, wie so überall in der Wissenschaft, noch viele Detailfragen offen sind, muss natürlich nicht noch mal extra erwähnt werden.)
31.10.2009 Reinhard Junker
Muss ich meine _glaubensmäßigen_ Überzeugungen in einem Lehrbuch, das sich kritisch mit Evolutionstheorien auseinandersetzt, bekennen? Wohl genausowenig, wie ein Atheist in einen wissenschaftlichen Buch sich zu seiner Überzeugung bekennen muss. Wie ich die biblischen Schilderungen über Gottes Handeln in dieser Welt verstehe und warum ich – von den biblischen Texten geleitet – motiviert bin, die Möglichkeit einer kurzen Erdgeschichte zu verfolgen, muss ich nicht in jeder meiner Publikationen thematisieren.
28.10.2009 Martin Neukamm
@ R. Junker: Das Postulat der 160 Mutationen gründet insofern nicht auf Unwissen, als es auf einem bestimmten Modell beruht. Das wurde nun als nicht realistisch erwiesen. Ja, gut, man lernt dazu, und man kann sich irren. — Ein faires Eingeständnis. Das hätte ich so deutlich nicht erwartet, vielen Dank!
23.10.2009 Wolfgang Jähnig
Ja, gut, man lernt dazu, und man kann sich irren. Dafür gibt es kritische Diskussionen. Diese Sätze schreibt nun R.Junker, obwohl er noch nicht einmal in der Lage ist zu erklären, ob er sich tatsächlich vom Kurzzeit-Kreationismus verabschiedet hat, kritische Diskussionen abwürgt und sich in Wider- sprüche verwickelt. Am 25.11.08 habe ich von Junker eine E-Mail erhalten und teilte u.a. folgendes mit: Ich gehöre tatsächlich zu den sogenannten Kurzzeit-Kreationisten – ein bescheuerter Begriff ! In der Rezension zum Buch Evolution im Fadenkreuz des Kreationismus gibt Peitz an, daß seit der 5. Auflage des Buches Evolution – ein kritisches Lehrbuch der Kurzzeitkreationismus nicht mehr vertreten wird. Ja, was trifft denn nun zu ???
20.10.2009 Reinhard Junker
Ob es klar gegeneinander abgrenzbare Basisfunktionszustände gibt, müssen Analysen in konkreten Fällen zeigen. Wenn das idealisierte Konstrukte sind, die es in der Natur nicht gibt, dann gilt das auch für Matzkes Stadien. Man kann eben in solchen Fällen nur mit Modellen arbeiten. Matzke arbeitet auch mit Basisfunktionszuständen, auch wenn er sie nicht so nennt. Er prüft aber nicht, mit welchem Aufwand an Änderungen sie überwunden werden können. Es wird eben bei weitem nicht jeder Einzelschritt durch die Selektion belohnt bzw. die Übergänge in Matzkes Modell sind weit davon entfernt, „Einzelschritte“ zu sein. Der Verweis auf multiple Funktionalität ist nicht mehr als ein „irgendwie wird es schon gehen.“ Vielleicht geht es ja, aber das muss gezeigt werden. Das Postulat der 160 Mutationen gründet insofern nicht auf Unwissen, als es auf einem bestimmten Modell beruht. Das wurde nun als nicht realistisch erwiesen. Ja, gut, man lernt dazu, und man kann sich irren. Dafür gibt es kritische Diskussionen. Matzke hat ein besseres Modell vorgelegt, jedoch nach meiner Kenntnis nicht in einer wissenschaftlichen Zeitschrift veröffentlicht und sein Modell selber z. B. in Pallen MJ & Matzke NJ (2006) From The Origin of Species to the origin of bacterial flagella. Nat. Rev. Microbiol. 4, 784-790 nicht zitiert – aus welchen Gründen auch immer. Das Matzkesche Modell lässt klar erkennen, dass die betreffenden Übergänge durch bekannte Mechanismen nicht überbrückt werden können. Das kann sich vielleicht in Zukunft ändern. Solange aber die Hoffnung, dass sich das ändern wird, nicht erfüllt ist, kann es genauso gut sein, dass das auch in Zukunft so bleibt. Daher haben wir auch in allen früheren Auflagen ab 1986 noch nie den Schluss gezogen, dass etwas unerklär_bar_ ist. Wir haben immer „unerklärt“ gesagt (siehe Abschnitt 3.3.6 der 1. Auflage 1986). Und das ist noch immer wissenschaftlicher, als Mutmaßungen oder Hoffnungen als bereits erfolgte Erklärungen auszugeben.
01.10.2009 Wolfgang Jähnig
Wieder eine semasiologische Verdrehung. Es ist doch absurd, daß anhand der Wortwahl des Buches , ein Fadenkreuz nur im Zusammenhang mit einer Schußwaffe gesehen wird. Hauptsächlich ist ein Fadenkreuz ein hinter das Okular von Fernrohren und Mikroskopen geschaltetes Kreuz aus Spinnfäden oder in Glas geritzten Strichen zum genauen Anvisieren eines Ziels. Vielleicht hätte man anstatt desWortes Fadenkreuz das Wort Fokus wählen sollen. Dann würde man eine Mißinterpretation von vornherein ausschließen.
24.09.2009 Martin Neukamm
Dass es Vorstufen mit anderer Funktion geben kann, ist explizit Ausssage bereits der ersten Auflage. ** Weshalb die Berücksichtigung von Basisfunktionszuständen aus der Sicht von ID keinen Sinn machen soll, verstehe ich nicht.—- Weil es keine klar gegeneinander abgegrenzten Basisfunktionzustände gibt. Das sind idealisierte Konstrukte, die es in der Natur nicht gibt. Da ein Merkmal multiple Funktionen haben kann, die unabhängig voneinander selektierbar sind, kommt es eben zur funktionellen Überlappung, wodurch ein gangbarer Evolutionsweg vorgezeichnet ist (vgl. S. 213ff sowie Abb. 36 u. 37 im Buch). Ein eindrückliches Beispiel hierzu ist der Bakterienmotor. Im EkL werden noch 160 simultane Mutationen postuliert, bevor die Selektion greifen kann. Nun konnte allerdings Matzke zeigen, dass der Prozess in (mindestens) 11 Zwischenschritte unterteilbar ist, wobei jeder Einzelschritt durch die Selektion belohnt wird. Siegfried Scherer problematisiert nun einen einzelnen Zwischenschritt und meint, das Problem sei für die Evolution noch immer nicht lösbar. Doch von der Notwendigkeit, 160 Simultan-Mutationen zu addieren, ist längst nicht mehr die Rede! Dieses Postulat wurde auf Unwissen gegründet – und dasselbe problematische Argument legt Scherer nun seiner neuerlichen Kritik zugrunde. Aus meiner Sicht gleicht dieses Argumentationsschema mehr einer Rolle rückwärts als einer gelungenen Verteidigung des IC-Arguments.
22.09.2009 Reinhard Junker
Die Wertlosigkeit bezieht sich auf die Funktion der jeweils betrachteten irreduzibel komplexen Struktur. Für sich allein ist der zitierte Satz missverständlich. Er steht aber in einem Kontext. Dass Vorstufen eine andere Funktion haben können, wird berücksichtigt. Das geht aus dem Kontext S. 306 hervor (Die Funktion des betreffenden Systems wird zerstört). Dort wird auch auf den Abschnitt IV.9.4 verwiesen, wo das genauer erklärt wird und wo dieses Zugeständnis ausdrücklich formuliert ist. Dort geht um die Basisfunktionszustände. Dass es Vorstufen mit anderer Funktion geben kann, ist explizit Ausssage bereits der ersten Auflage. ** Weshalb die Berücksichtigung von Basisfunktionszuständen aus der Sicht von ID keinen Sinn machen soll, verstehe ich nicht.
16.09.2009 Martin Neukamm
@ R. Junker: „Immerhin – so könnte man an dieser Stelle einwenden – ist das Zugeständnis, dass selektionspositive Zwischenstufen als denkbar anerkannt werden, schon mehr als das Bestreiten solcher Zwischenstufen beim Argument irreduzierbarer Komplexität.“ — Dieses „Zugeständnis“ gibt es in allen Auflagen des kritischen Lehrbuchs. Dieses Zugeständnis macht aus Sicht von ID aber keinen Sinn; die Existenz funktionaler Zwischenformen wird entgegen Ihrer Behauptung sehr wohl bestritten. So heißt es auch im kritischen Lehrbuch auf S. 306f. klipp und klar: Die irreduzible Komplexität muss […] in einer einzigen Generation entstehen, sie kann nicht kumulativ (schrittweise) aufgebaut werden, da Zwischenstadien der Selektion zum Opfer fielen […] Die Tatsache, dass Lebewesen (im Gegensatz zu technischen Systemen) sich selbst fortpflanzen können und daher über mehrere Generationen Komplexität schrittweise aufbauen könnten, wird hier ausdrücklich berücksichtigt. Denn VORSTUFEN IRREDUZIBEL KOMPLEXER SYSTEME SIND WERTLOS UND WERDEN DAHER AUSGELESEN (Hervorhebung von mir). Dass Vorstufen von IC-Systemen wertlos sind und ausgelesen werden, widerspricht doch wohl eindeutig Ihrer oben gemachten Aussage.
08.09.2009 Reinhard Junker
Einige Klarstellungen und Hinweise: ** „Immerhin – so könnte man an dieser Stelle einwenden – ist das Zugeständnis, dass selektionspositive Zwischenstufen als denkbar anerkannt werden, schon mehr als das Bestreiten solcher Zwischenstufen beim Argument irreduzierbarer Komplexität.“ Dieses „Zugeständnis“ gibt es in allen Auflagen des kritischen Lehrbuchs. Entscheidend ist die Bestimmung von „Basisfunktionszuständen“ als möglichen Zwischenstufen (wird im Lehrbuch erläutert). Außerdem wird die Thematik der nichtreduzierbaren Komplexität hier ausführlich kritisch diskutiert inklusive des Arguments der selektionspositiven Zwischenstufen: http://www.genesisnet.info/schoepfung_evolution/p1624.php (PDF, ca 1 MB). ** „Scherer schließt methodisch jedenfalls nicht von der – seiner Meinung nach – derzeitigen Unerklärtheit auf eine grundsätzliche Unerklärbarkeit.“ Das macht auch sonst niemand von der Studiengemeinschaft Wort und Wissen und wurde auch noch nie im kritischen Lehrbuch gemacht. Den „Fehlschluss vom Ignoramus (wir wissen es nicht) zum Ignorabimus (wir werden es nicht wissen)“ wird man bei Wort und Wissen vergeblich suchen. ** „Völlig zu Recht folgt für Neukamm aus der Tatsache, dass es offene Fragen in der Evolutionsbiologie gibt, keinesfalls, dass die Bemühungen um ausschließlich natürliche Erklärungen fehlgeschlagen sind (306).“ Im kritischen Lehrbuch wird das nur hier und da für bisherige Bemühungen gesagt. Und das ist korrekt. Über zukünftige Versuche wird damit nichts gesagt, siehe oben. Daher gibt es weder im kritischen Lehrbuch noch sonstwo bei Wort und Wissen ein „nacktes“ argumentum ad ignorantiam. Ein Nichtwissen kann immer nur im Kontext eines Wissens von Bedeutung sein. Ganz allgemein gesagt: Wenn eine teleologische Entstehungsweise eines Gegenstandes bekannt ist und keine nichtteleologische, dann kann man den Schluss auf die beste (bzw. in diesem Fall einzig bislang bekannte) Erklärung ziehen (eben die teleologische). Das Nichtwissen über einen nichtteleologischen Entstehungsweg erlaubt diesen Schluss; er ist aber nicht zwingend. ** „Wenn schon vergleichsweise einfache synorganisierte technische Systeme bekanntermaßen [Appell an die Alltagserfahrung …] nur durch Designer entstehen, dann gilt dies erst recht für die viel komplizierteren Lebensstrukturen (307).“ Das ist nicht nur ein Appell an die Alltagserfahrung, sondern an unsere bisherige ausschließliche Erfahrung auch in der Wissenschaft, was das erstmalige Entstehen betrifft. Der zitierte Satz steht natürlich in einem Kontext, in welchem er kritisch diskutiert wird! Ich hoffe, dass dieser Kontext in der Zitation im „Fadenkreuz“-Buch den Lesern nicht vorenthalten wird. ** Übrigens finde ich es bedauerlich, dass ein Buch, in dem es offenbar sehr viel um „Evolution ein kritisches Lehrbuch“ und die SG Wort und Wissen geht, die Wendung „Im Fadenkreuz“ gewählt wurde. Die Mitarbeiter des Lehrbuchs und der SG W+W schießen nicht auf Evolution, wir setzen uns kritisch mit evolutionstheoretischen Hypothesen auseinander – ein großer Unterschied!








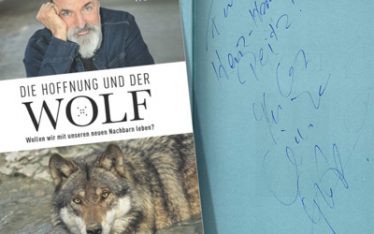

Recent Comments