Stephen Hawking, britischer Astrophysiker und Autor bekannter Bestseller wie „Eine kurze Geschichte der Zeit“ von 1988, legt zusammen mit dem Physiker Leonard Mlodinow nun den „großen Entwurf“ vor, der „eine neue Erklärung des Universums“ liefern soll. Zum einen glaubt er, der Weltformel (theory of everything) nahe zu sein, zum anderen maßt er sich an, damit die letzten Fragen der Menschheit beantworten zu können. Fundamentale Fragen wie „Warum gibt es etwas und nicht einfach nichts?“ waren bisher Gegenstand der Philosophie, die Hawking schon im zweiten Absatz des Buches schlicht für tot erklärt (S. 11). Die Autoren behaupten, „dass es möglich ist, diese Fragen ausschließlich in den Grenzen der Naturwissenschaft und ohne Rekurs auf göttliche Wesen zu beantworten“ (S. 168). Damit wird auch der Rückgriff auf Gott als Schöpfer entbehrlich, denn das Universums entsteht spontan aus dem Nichts:
„Da es ein Gesetz wie das der Gravitation gibt, kann und wird sich das Universum … aus dem Nichts erzeugen. Spontane Erzeugung ist der Grund, warum es das Universum gibt, warum es uns gibt. Es ist nicht nötig, Gott als den ersten Beweger zu bemühen, der das Licht entzündet und das Universum in Gang gesetzt hat.“ (S. 177)
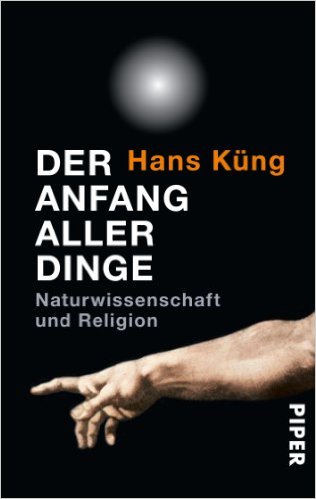 Damit ist Hawkings atheistisches Bekenntnis ausdrücklich geworden, anders als vor 22 Jahren in der „kurzen Geschichte der Zeit“, deren letzten Worte noch vom „Plan Gottes“ sprachen – gern zitiert und auch von heutigen Zeitungsartikeln noch als Hinweis der möglichen Vereinbarkeit von Naturwissenschaft und Religion gewertet. Ein Sinneswandel Hawkings‘ also?
Damit ist Hawkings atheistisches Bekenntnis ausdrücklich geworden, anders als vor 22 Jahren in der „kurzen Geschichte der Zeit“, deren letzten Worte noch vom „Plan Gottes“ sprachen – gern zitiert und auch von heutigen Zeitungsartikeln noch als Hinweis der möglichen Vereinbarkeit von Naturwissenschaft und Religion gewertet. Ein Sinneswandel Hawkings‘ also?
Nicht wirklich! Auch ohne Kenntnis des neuen Buches konnte Hans Küng 2005 den Hinweis auf den Plan Gottes kommentieren: „Das war selbstbewusst gedacht und ironisch gemeint. Denn Hawkings Meinung war: Mit einer solchen vereinheitlichten ‚Theorie für alles‘ … würde die Welt sich selbst erklären und Gott als Schöpfer nicht mehr notwendig sein“ (Der Anfang aller Dinge, München 2005, 31). Gut vorweggenommen, was jetzt explizit vorliegt!

Godehard Brüntrup: Hawkings Behauptung der Selbsterschaffung des Universums ist eine „kognitive Katastrophe“
Hawking ergänzt damit kosmologisch, was Richard Dawkins evolutionstheoretisch versucht hat: den Schluss von den Naturwissenschaften zur Nichtexistenz Gottes. Dass dies nur mit wissenschaftstheoretischer Ignoranz und Arroganz möglich ist, bezeugen zahlreiche der unten wiedergegebenen Pressebeiträge. Die fundamentalste und gleichzeitig einfache Entgegnung weist Hawking logische Widersprüche nach: „Wie kann etwas sich selbst aus nichts erschaffen? Um wirken zu können, muss dieses ‚etwas‘ … existieren, denn etwas, was nicht existiert, kann auch nichts bewirken. Andererseits soll dieses ‚etwas‘ ja gerade nicht existieren, sondern aus nichts hervorgehen … Hawking behauptet also, dass das Universum gleichzeitig und unter der selben Rücksicht existiert und nicht existiert. Das ist ein glatter logischer Widerspruch“, so Godehard Brüntrup in der Tagespost vom 14.09. (ausführlicher unten im Pressespiegel).
Ungeachtet aller Kritik wird das neue Buch – wie bei den anderen „Feuilleton-Athisten“ (Johanna Rahner) – dennoch zum Kassenschlager werden können. Hawking hat dafür mit den provokativen Thesen kurz vor der Veröffentlichung einen ähnlichen Beitrag geleistet wie seinerzeit der Schlusssatz mit dem Plan Gottes, der beinahe der Endredaktion zum Opfer gefallen wäre. Beinahe, denn mit der Streichung „hätte ich womöglich die Verkaufszahlen halbiert“, weiß der Spiegel Hawking zu zitieren. Die Breitenwirkung (das engl. Original läuft bei amazon.com bereits am 6. Sept. selbst der Belletristik den Rang ab: Platz 1) rechtfertigt denn auch eine ausführliche Auseinandersetzung mit dem Buch, dessen Thesen zahlreiche fundamentale Anknüpfungspunkte für Diskussionen bietet:
- Was ist innerwissenschaftlich von der propagierten M-Theorie zu halten? Wie solide und empirisch fundiert sind die Stringtheorien? Wie konkurrenzfähig sind Alternativtheorien?
- Inwieweit sind – erkenntnistheoretisch gefragt – die Theorien Konstrukte, inwieweit beschreiben sie „Wirklichkeit“? Was meint Hawkings „modellabhängiger Realismus?“
- Wo liegen in wissenschaftstheoretischer Hinsicht die Grenzen naturwissenschaftlicher Modelle – gegen die Anmaßung, Metaphysik durch Physik ersetzen zu können?
- Was ist theologisch unter „Schöpfung aus dem Nichts“ zu verstehen – im Unterschied zu dem „Nichts“, aus dem das Universum spontan entstehen soll und das Hawking wie viele andere vor ihm (z. B. Frank Wilczek, Rolf Ebert, Peter Atkins) mit dem theologischen „Nichts“ verwechseln?
Die nachfolgende Presseschau, in der auch Hawking selbst mit der Zusammenfassung seines Buches (2010/09/03: Why God Did Not Create the Universe – The Wall Street Journal) einen guten Einstieg bietet, widmet sich diesen Fragen in unterschiedlicher und kontroverser Weise.











Recent Comments