Frisch gekauft und angelesen! Hier mein erster Leseeindruck:
Nachdem sich der Kämpfer für den Atheismus im „Gotteswahn“ so richtig abreagiert und nicht nur den Kreationismus, sondern Religion insgesamt verteufelt hat, schlägt sein neues Buch vermeintlich andere Töne an: „Es richtet sich nicht gegen die Religion. Ein solches Buch habe ich bereits geschrieben, aber das ist ein anderes Paar Schuhe, und ich möchte es hier nicht noch einmal bemühen“ (14f.). Vielmehr handle dieses Buch „von den Belegen dafür, dass die Evolution eine Tatsache ist“ (14). Während die Behauptung der religionskritischen Enthaltsamkeit beim englischen Originaltitel „Greatest Show on Earth“ noch glaubwürdig erscheinen konnte, steht sie nun in krassem Kontrast zum deutschen Titel der „Schöpfungslüge“. Hat sich Ullstein hier sensationsfreudig im Ton vergriffen?
Aus eigener Erfahrung weiß Dawkins von gelungenen Kooperationen mit Kirchenvertretern zu berichten und betont: „Häufig wird zu Recht darauf hingewiesen, dass führende Kleriker und Theologen kein Problem mit der Evolution haben und die Wissenschaftler in dieser Hinsicht sogar aktiv unterstützen“ (13). Namentlich nennt er nicht nur den Erzbischof von Canterbury, sondern auch den Papst (obwohl er hier ein Grummeln über dessen Verständnis der Seelenentstehung nicht unterbinden kann), ja er weiß ausgebildete Priester und Theologieprofessoren ausdrücklich auf Seiten der Evolutionsbefürworter.
Generös gesteht Dawkins ihnen zu: „Sie glauben vielleicht, Gott habe den Prozess in Gang gesetzt und alles Weitere sich selbst überlassen. Vermutlich nehmen sie an, dass Gott das Universum überhaupt erst eingerichtet hat, wobei er es mit einer harmonierenden Reihe von physikalischen Gesetzen und Konstanten veredelte, die einen undurchschaubaren Zweck erfüllen sollten, für den wir irgendwann auch eine Rolle spielen würden“ (15). Abgesehen davon, dass kaum einer der „aufgeklärten“ Theologen ein so deistisches Gottesbild vertritt, für Dawkins ist entscheidend: „Alle nachdenklichen, rationalen Kirchenmänner und -frauen erkennen die Belege für die Evolution an“ (15).
Gemeinsam gegen den Kreationismus
Allerdings mahnt Dawkins, man dürfe nicht „selbstzufrieden annehmen, nur wiel Bischöfe und gebildete Geistliche die Evolution anerkennen, würden ihre Gemeinden das Gleiche tun“ (15). Umfragen zufolge leugneten hier im Schnitt 40% die Evolution, und „das sollte die Kirchen ebenso beunruhigen wie Wissenschaftler“. Darum fände er es schön, wenn „die aufgeklärten Bischöfe und Theologen … sich ein wenig mehr für die Bekämpfung des wissenschaftsfeindlichen Unsinns engagieren würden, den sie selbst beklagen“ (16). Es ist also weniger die einsetzende Altersmilde als der gemeinsame Gegner „Kreationismus“, der so ungleiche Elemente wie Dawkins und Theologen zusammenschmiedet. Im Verein mit diesen will Dawkins diejenigen wappnen, die sich argumentativ gegen Evolutionsleugner nicht hinreichend gerüstet sehen.
Jenseits der strategischen Allianz
Die Allianz mit den Theologen geht freilich über das Strategische nicht hinaus. Gönnerhafte bis antireligiöse Spitzen durchziehen nach Meinung des Rezensenten Randy Olson – selbst Biologe – das ganze Buch: „Es hat etwas Komisches: Wenn das Auffinden gönnerhafter Herablassungen ein neues Trinkspiel wäre, na dann Prost! In jedem Kapitel wird man fündig“, so Olson zur englischen Ausgabe im New Scientist vom 09.09.09. Auch wenn Dawkins im Vorfeld versichert, dies sei kein antireligiöses Buch, könne er es nicht lassen, der Religion durchgängig eins zu verpassen. Man bekomme den Eindruck, Dawkins habe dies nicht mehr unter Kontrolle. „Es ist, als leide er unter einer Form von antireligiösem Tourette-Syndrom“, diagnostiziert Olson.
Kernabsicht: Belege für die Evolution
Nehmen wir die antireligiösen Affronts aber einmal beiseite und den Hauptzweck des Buches, Argumente für die Evolution stark zu machen, ernst. Exemplarisch sei als Beispiel die Entwicklung der Hunde herausgegriffen, mit der Dawkins die Mechanismen der Evolution plausibel machen will.
Der Bogen zu den umfassenden Antworten setzt mit einfachen Fragen an: Wussten Sie z. B., dass der Wolf längst über die natürliche Selektion domestiziert war, bevor die menschliche Zucht ansetzte? Oder, dass man an der Fuchs-Zucht evolutive Nebeneffekte studieren kann?
Die Antworten auf diese Fragen (87-93) sind informativ, kenntnisreich und plausibel – soweit ich das beurteilen kann -, enden allerdings mit einem gewagten Schluss. Dawkins lädt den Leser ein, die Entstehungszeit der unterschiedlichsten Hunderassen in die Vergangenheit zu extrapolieren (99-100), und schließt: „Dann kann man sich recht einfach mit dem Gedanken anfreunden, dass die Evolution auch solch riesige Veränderungen erzeugen konnte, durch die ein Fisch sich in einen Menschen verwandelte.“ (100). Diese scheinbar so plausible Extrapolation überspielt, dass es nicht nur um quantitative Veränderungen geht (wie vom Wolf zum domestizierten Hund), sondern um qualitative Bauplanänderungen (vom Fisch zum Menschen). Evolutionsgegner werden sich sofort auf den Unterschied zwischen Mikro- (Hundeevolution) und Makroevolution (vom Fisch zum Menschen) stürzen.
Wenn Dawkins tatsächlich diejenigen wappnen will, die sich argumentativ gegen Evolutionsleugner nicht hinreichend gerüstet sehen, sollte er solche Scheinplausibilitäten tunlichst durch tragfähige Argumente ersetzen oder untermauern. Die Qualität des Gesamtbuches wird sich an dieser Selbstverpflichtung messen lassen müssen.

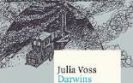









Recent Comments