Den Versuch, die absolute Bedeutung Jesu Christi mit der Evolution zusammen zu bringen, hat in prägnantester Weise der geniale Naturwissenschaftler und Wissenschaftsjournalist Hoimar von Ditfurth in seinem lesenswerten Dialogangebot „Wir sind nicht nur von dieser Welt“ (Hamburg 1981, hier 21-22) kritisiert:
„Die evolutionistische Betrachtung zwingt nun unvermeidlich auch zu einer kritischen Überprüfung bestimmter religiöser, insbesondere christlicher Formulierungen. Dies gilt … offensichtlich etwa für den zentralen christlichen Begriff der ‚Menschwerdung‘ Gottes. Es ist kein Zweifel daran möglich, dass Jesus Christus vom Neandertaler nicht als ‚Mitmensch‘ hätte begriffen werden können (eher schon als göttliches Wesen). Das gleiche gilt, vice versa, nun aber auch angesichts unserer zukünftigen Nachfahren. Die Absolutheit, die dem Ereignis von Bethlehem im bisherigen christlichen Verständnis zugemessen wird, steht im Widerspruch zu der Identifikation des Mannes, der dieses Ereignis personifiziert, mit dem Menschen in der Gestalt des Homo sapiens. … Ich sehe nicht, wie sich der Widerspruch anders beseitigen ließe als durch das Zugeständnis einer grundsätzlichen historischen Relativierbarkeit auch der Person Jesus Christus. Warum eigentlich sollte das nicht möglich sein, ohne dass die Substanz berührt wird, auf die allein es ankommt?“
Der Tübinger Dogmatiker Jochen Hilberath hat auf der Tagung „Jesus Christus für alle?“ erläutert, was mit dem umstrittenen „Absolutheitsanspruch“ Jesu Christi gemeint ist. Sehen und hören Sie selbst:
Den gesamten Vortrag von Jochen Hilberath können Sie auf unserem Youtube-Kanal verfolgen.
Hilberath hält es also für falsch, von einem Absolutheitsanspruch des Christentums zu reden. Aber es gebe den Absolutheitsanspruch Gottes auf jeden Menschen: „Gott will das Heil jedes Menschen.“ Dieser Heilswille Gottes lasse sich durch nichts relativieren. „Und das Christentum – vielleicht auch andere Religionen – will genau das bezeugen.“ Weil es diesen absoluten, durch nichts einzuschränkenden Anspruch Gottes auf das Heil eines jeden Menschen gebe, ließen sich auch keine Bedingungen für das Zum-Heil-Kommen aufstellen.„Gott will, dass alle Menschen gerettet werden!“ Anders als von Ditfurth vermutet, würde daher die Preisgabe dieses Anspruchs durchaus einen Substanzverlust bedeuten. So eindrucksvoll Hilberath dies plausibel macht: Es gab auf facebook auch Unverständnis.
Reaktion auf facebook
Teilnehmer 1:
„Ich habe nur die kurze Sequenz gesehen und ich bin ziemlich fassungslos. Bisher konnte noch niemand zeigen, dass es überhaupt einen Gott gibt, und da stellt sich einer hin und sagt x-Mal ‚Gott will‘, und das auch noch absolut und nicht verhandelbar. Hmmmm, vielleicht ist es eine Kurzform von ‚Sollte es den Gott geben, der so ist, wie ich ihn mir vorstelle, dann …‘, was vermutlich eine Form von ‚Wenn die Katze ein Pferd wäre, könnten wir Bäume hinaufreiten‘ darstellt.“
Teilnehmer 2 zu Teilnehmer 1:
„Newton fand eine Fernwirkung auch jenseits des Vorstellbaren, aber konnte sich hinstellen und dreist Formeln dafür aufstellen und das noch absolut und nicht verhandelbar. Ich weiß, dass der Vergleich hinkt, aber so läuft es überall im Leben: Ob es ein ‚ich‘ gibt, ist nicht bewiesen, doch schreiben die Psychologen Bibliotheken darüber.
Die Problematik, dass die Begegnung mit Gott (= Rede von Gott in der 2. Person) das Primäre ist und das Bezeugen Gottes (= Rede von Gott in der 3. Person) das Sekundäre, ist Teil der Theologie.
Theologie ist Reflexion über das Christsein und damit eine praktische Wissenschaft. Das Leben als Christ ist aber wie jede menschliche Existenz voller Voraussetzungen, die man nicht vollständig rational einholen kann. Da gehören Fassungslosigkeiten dazu. Ich bin fassungslos, dass Sie das nicht erfassen können.“
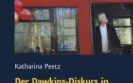









Recent Comments