Die Zeitschrift „Theologie und Philosophie“ bietet den Artikel „Die Dogmen des Naturalismus“ von Hans-Dieter Mutschler (ThPh 89, 2014, 161-176) zum kostenlosen Download an. Der Artikel fasst einen Aspekt des Buches „Halbierte Wirklichkeit“ zusammen, dort als „Die drei Säulen des Materialismus“ bezeichnet. Ich darf Ihnen hier die Zusammenfassung des Artikels anbieten und ergänze dies durch Hinweise auf den weiteren Argumentationsgang des Buches. (hhp)
Die drei Säulen des Materialismus
In dem Artikel will Hans-Dieter Mutschler die häufig geäußerte Meinung widerlegen, der Materialismus könne sich zu Recht auf die Naturwissenschaft berufen. Dazu untersucht Mutschler drei Prinzipien, auf denen der Materialismus beruhe: 1. das Materieprinzip, 2. das Supervenienzprinzip, 3. das Kausalprinzip. Am Ende wird Mutschler zu dem Ergebnis kommen, dass 2 nicht durchgängig gilt und dass 1 und 3 aus der praktischen Lebenswelt abgeleitet sind, nicht jedoch aus der Naturwissenschaft.
Zu 1
Materie als vermeintlich letzte Basis, auf der alles aufbaut, kommt nach Mutschler in keiner physikalischen Formel vor. Überhaupt sei es schwierig, das ontologische Substrat zu bestimmen, auf das sich die Physik bezieht – erst recht ließen Relativitäts und Quantentheorie fragen, auf welche substanziellen Größen sie sich beziehen. Eine allgemeinverbindliche Ontologie der Physik gebe es (bislang) nicht, ein vermeintlich Letztes könnte sich fraktal immer wieder auflösen. Wer ein Letztes (Materie) gefunden zu haben vorgibt, trage die Beweislast; in der Physik finde er jedenfalls keine Bestätigung.
Zu 2
Gegenüber dem Supervenienzprinzip, nach dem die (materielle) Basis den Überbau zwingend festlegt, führt Mutschler das „Misslingen solcher Reduktionsprogramme“ ins Feld. So werde das Supervenienzprinzip häufig verletzt: Die Eigenschaften eines Lebewesens supervenierten nicht auf den Genen, der Geist nicht auf dem Gehirn und die Bedeutung eines Bildes nicht auf den Pixeln, da Erkennen nicht kausal erfolge, sondern durch Interpretation. Die Verletzung des Prinzips gelte für sämtliche Zweck-Mittel-Relationen, da Mittel die Zwecke nicht festlegten, sondern verschiedenen Zwecken dienen könnten. Biologisches Beispiel dafür sei die Exaptation, insofern Federn dem Zweck der Wärmeregulierung, später dann dem Gleiten dienen können: Die Zwecke supervenierten also nicht auf der Struktur der Feder. Und da man grundsätzlich wisse, dass Experimente nicht zwingend zu einer bestimmten Theorie führen, sondern „empirisch unterdeterminiert sind“, bedeute dies: „Naturwissenschaft widerspricht in fundamentaler Weise dem Supervenienzprinzip“ statt es zu stützen.
Zu 3
Beim Prinzip der kausalen Geschlossenheit der Welt (vereinfacht „Kausalprinzip“) fällt Mutschler zunächst die heterogene Verwendung des Wortes „Kausalität“ auf. Abgesehen davon gäbe es nach Bertrand Russel inhaltliche Probleme: „Wenn ein Weltzustand kausal erklärt werden soll, dann wird es sehr viele notwendige Teilursachen geben, von denen nicht sicher ist, ob wir sie zu einer hinreichenden aufaddieren können“. Theoretisch müsse das ganze Universum berücksichtigt werden. Da dies unmöglich ist, kann man – in meinen Worten [hhp] – aus den bekannten notwendigen Voraussetzungen nicht schließen, dass es weitere Voraussetzungen geben muss, die in Summe eine hinreichende Voraussetzung bilden. Für praktische Zwecke jedoch seien endliche Summen präzise genug. Damit aber lasse sich „das Kausalprinzip nur pragmatisch, nicht aber streng theoretisch rechtfertigen“, von einer ontologischen Deutung ganz zu schweigen. Es gehe als nicht um Ontologie, sondern um eine bloße (allerdings notwendige) Forschungsmaxime. Als solche habe sie einen subjektiven, keinen objektiven Charakter.
Wie der Materiebegriff so sei auch der Kausalitätsbegriff eher von der praktischen Lebenswelt abhängig (ich bewege ein Objekt). Unser Eingreifen in die Natur (Lebenswelt) sei also primär und das Modell von Kausalität. Damit ist nicht – wie im materialistischen Paradigma – Handlungskausalität von Naturkausalität abzuleiten, sondern umgekehrt Naturkausalität von Handlungskausalität. Diese Projektion der Handlungskausalität in die Natur habe aber mit Strawson ihre Grenzen: „In den feinstgesponnenen Bereichen physikalischer Theorie … haben diese Modelle anscheinend allesamt ausgedient. … Verursachung wird von Mathematik aufgesogen“. Dementsprechend wäre nach Mutschler „der größte Teil des makro- und mikrophysikalischen Bereichs eine kausalitätsfreie Zone“. Mutschlers Bilanz: „Von ‚kausaler Geschlossenheit‘ könnte nun aber keine Rede mehr sein.“
Fazit
Aus dem Befund, dass das Supervenienzprinzip nur partiell gelte und Materie- wie Kausalprinzip letztlich von der Lebenswelt abzuleiten seien, legt sich für Mutschler eine andere als die materialistische Ontologie nahe. Da wir uns nicht materialistisch als Epiphänomene des Gehirns empfänden, aber auch nicht substanzdualistisch als separierte Geister, lege sich eine psychosomatische Einheit, eine Überlagerung geistiger und materieller Prozesse nahe. Und sofern wir „keine analogielosen Ausnahmeerscheinungen in einer prinzipiell fremden Natur sein, dann werden wir diesen psychosomatischen Zusammenhang auch für die Natur behaupten“. Damit wünscht sich Mutschler die Reformulierung einer Aristoteles nahen „Form-Materie-Dialektik“.
Die drei Säulen des Materialismus – leicht erklärt
[fvplayer src=“https://youtu.be/-qM8HtMdhuc“]
Der weitere Argumentationsgang des Buches
Der Hinweis auf die „Form-Materie-Dialektik“ ist nur ein philosophisches Zwischenfazit. Über den obigen Artikel hinaus zielt das Buch auf eine „narrative Theologie der Natur“ (303-328), die bescheidener sei als eine sehr voraussetzungsreiche „metaphysische Großerzählung“ wie z. B. bei Whitehead (303). Dies ist Mutschlers Option, um die Entstehung des Neuen in der Natur zu erklären, wenn man diese innovative Kraft der Natur nicht einfach als unableitbar gegebenes factum brutum und Mysterium hinnehmen will. Mutschler weiß, dass er den Bereich des allgemein vernünftig Begründbaren überschritten hat, allerdings sprächen für seine Option „Plausibilitätsargumente“ (132f, hier eine gute Zusammenfassung des Argumentationsgangs).
Eine solche narrative Theologie der Natur verteidigt Mutschler gegen zwei potenzielle Einwände: 1. die unendliche Größe des Kosmos, die aber nur dann sperrig sei, wenn man Quantität vor Qualität setzt; und 2. das unlösbare Theodizeeproblem, demgegenüber jedoch die Abschaffung Gottes neue Probleme aufwerfe. Dann nämlich gäbe es „keine Gerechtigkeit für die Opfer der Geschichte“ (303, vgl. Zusammenfassung ebd.). Mutschler schließt:
„Wer diesen Gedanken erträgt, ohne depressiv, abgestumpft oder zynisch zu werden oder ohne den Sachverhalt einfach nur zu verdrängen, der möge dies tun. Er soll aber nicht meinen, dass er das Problem, das durch die Theodizeefrage aufgeworfen wird, zum Nulltarif wieder los wird. Wir haben die Wahl zwischen Skylla und Charybdis. Die Wahl des Glaubens scheint unter diesen Umständen aber nicht die schlechteste, so wie die gläubige rélecture der Evolution sich angesichts der Alternativen, die uns angeboten werden, sich sehr wohl sehen lassen kann.“ (328)

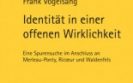








Recent Comments