Das zweite Quartalsheft des Magazins „Welt und Umwelt der Bibel“ widmet sich schwerpunktmäßig dem Thema „Die Schöpfung: Bibel kontra Naturwissenschaft?“. Schon der erste Blick ins Heft macht neugierig: Die Redakteurin, Helga Kaiser, hat renommierte, einschlägige Fachleute gewinnen können, die das Thema facettenreich auf 60 anschaulich illustrierten Seiten entfalten.
Helga Kaiser zum Themenheft
[fvplayer src=“https://www.youtube.com/watch?v=LEppkYSe6Do&feature=youtu.be“ chapters=“http://www.forum-grenzfragen.de/uploads/sprungmarken/wub_2016.vtt“]
Bestätigt sich nach der Lektüre der erste gute Eindruck?
Eine Besprechung von Heinz-Hermann Peitz
Abschied vom Konfliktmodell
Schon das Editorial macht das Gesamtziel des Themenschwerpunkts transparent: Man will sich vom Konfliktdenken, das sich nach Ansicht der Redaktion bis heute hartnäckig gehalten habe, verabschieden und „Wege jenseits des Entweder-oder“ (1) aufzeigen. So empfiehlt der Religionspädagoge Martin Rothgangel als Alternativen zum Konfliktmodell die Modelle der Unabhängigkeit, des Dialogs oder der Integration, jeweils mit eigenem Potenzial für bestimmte Zielgruppen (39). Da das Konfliktmodell vor allem vom Kreationismus auf der einen und vom Atheismus auf der anderen Seite bedient werden, versteht es sich, dass sich das Heft ausdrücklich von Kreationismus und Intelligent Design (40-46) als auch vom Atheismus eines Richard Dawkins (47) oder eines Stephen Hawking (14f.) distanziert. Für meinen Geschmack hätte dabei der Atheismus allerdings mindestens genauso ausführlich thematisiert werden können wie der Kreationismus – was auch der gesellschaftlichen Verbreitung eher entsprochen hätte. Aus der Sicht eines Magazins, bei dem die Bibel im Zentrum steht, ist die vorgenommene Gewichtung jedoch gut nachvollziehbar.
Einführung
Für einen dieser Wege empfiehlt Helga Kaiser in ihrer Einführung eine „Weggefährtenschaft“ (Michael Blume): „Forschende und Glaubende können gemeinsam mit Begeisterung staunen“ (9). In der Tat könnte das Staunen eine Brücke sein. Das Buch von Harald Lesch und Christian Kummer „Wie das Staunen ins Universum kam“ hätte an dieser Stelle für einen Lesetipp gut sein können; immerhin taucht es in Form von Werbung an anderer Stelle (51) auf.
Dialektik von Erklären und Deuten
Sodann stellt der Theologe Ulrich Lüke, bekannt für seine geistreichen Wortspiele („Mit dieser ‚Hawking’schen Weltformel‘ … kann man wohl gottlos werden, nicht aber Gott loswerden“), die rhetorische Frage „Ergänzung oder Widerspruch?“. Lüke setzt bei der Ergänzung auf die „Dialektik von Erklären und Deuten“: „Wo die Schöpfungstheologie sich lernend auf die fachlichen Erklärungen der Naturwissenschaft einlässt, sie … philosophisch-theologisch weiterdenkt, und wo die Naturwissenschaft bei all ihren faszinierenden Erklärungen ihre philosophisch-theologische Deutungsbedürftigkeit anerkennt, da müsste beiderseits die falsche Frontstellung überwunden sein“ (17). Jenseits der Konflikte hält Lüke die Brücke, die Teilhard de Chardin zwischen Naturwissenschaft und Theologie gebaut hat, nach wie vor für tragfähig. Teilhards prägnante Formulierung „Gott macht eine Welt, die sich macht“ verbindet beides, Naturwissenschaft (eine Welt, die sich selbst macht) und Schöpfungslehre (Gott macht …).
Staunen vor dem Universum
Der Physiker Wolfgang J. Duschl blickt zurück in die fernste Vergangenheit der „Geburtsstunde des Universums“ und thematisiert dabei die erkenntnistheoretischen Schwierigkeiten, da es kein Außen gibt, von dem aus man sich das Universum zum Gegenstand erheben könnte. Auf den physikalischen Formalismus hin konkretisiert fehlt bisher noch die Kombination von Quanten- und Relativitätstheorie, die zur Beschreibung des Anfangsuniversums notwendig ist. Dabei wundert sich Duschl einerseits, „dass wir Menschen mit unseren höchst begrenzten Mitteln überhaupt ein tragfähiges System hinter dem entdecken können, was wir staunend beobachten“. Andererseits bezweifelt er, dass „wir Menschen überhaupt eine Chance haben, das Weltall eines – vielleicht auch noch so fernen – Tages komplett zu verstehen“. Und so bleibt wieder einmal das Staunen: „Ganz gleich, ob wir tief religiös sind oder Agnostiker, wir müssen anerkennen, dass das Universum großartiger, umfassender ist als das, was wir erkennen“ (25).
Soweit d’accord. Problematisch erscheint mir jedoch, wie die Schöpfungsthematik eingebracht wird. Ich bin mir nicht sicher, ob Duschls Fachkollegen mitgehen, wenn dieser die künftige Einsicht für möglich hält, „dass unsere heutige Urknall-Kosmologie als detaillierte Faktenbeschreibung auch nicht viel mehr wissenschaftliche Qualität aufweist als die Schöpfungsgeschichte in sieben Tagen“ (25). Die Vergleichbarkeit der so unterschiedlichen Begriffe will nicht so recht einleuchten, wenn Duschl eher assoziativ von dem spricht, „was wir Schöpfung oder Urknall nennen“ (25), oder gar das Universum als den „komplettesten Ausdruck der Schöpfung an sich“ (19) versteht. Und die Vermutung, dass im Blick auf Religion, Philosophie und Naturwissenschaft heutzutage „die Unterschiede in den Auffassungen so gering sind wie nie zuvor“ (19), verkennt die kategoriale Verschiedenheit der drei Zugangsweisen zur Wirklichkeit. Sollte damit jedoch gemeint sein, dass die Chancen der Begegnung durch das gemeinsame Staunen über das jedem Zugang zugrunde liegende Unzugängliche besser sind als zuvor, mag dies jenseits von Kategorienfehlern hoffnungsvoll stimmen. Die Verbindung der Zugangsweisen kann aber auch dadurch erkauft worden sein, dass der Schöpfungsbegriff komplett säkularisiert wurde, was der Autor auch nahelegt: „Ich gebrauche Schöpfung hier in einem sehr weiten, nicht notwendigerweise religiösen Sinn“ (19).
Was die Bibel unter „Schöpfung“ versteht
Was die Bibel indes mit Schöpfung meint wird durch eine Textzusammenstellung von Bettina Wellmann nahegebracht (26-35). Perikopen aus der gesamten Bibel belegen, dass sich das Thema Schöpfung nicht auf die bekannten Genesistexte beschränkt, sondern ein biblisches Querschnittsthema darstellt. Zum angemessenen Verständnis dieser Texte stellt ein kurzer Beitrag des bekannten Alttestamentlers Erich Zenger klar, dass die literarische Gattung zu berücksichtigen ist. Als Ur-Geschichte sind die Schöpfungstexte – nun wieder bezogen auf die Genesis – weder Geschichte, noch überholte und „primitive Naturwissenschaft“. Ihre Aufgabe ist vielmehr, die „Grundbestimmungen freizulegen, die für Welt und Mensch im Ganzen und immer schon gelten“ (28).
Panentheismus und Prozesstheologie
Vom biblischen zum systematischen Schöpfungsverständnis. Die Theologin Sabine Pemsel-Maier will mit Hilfe der Prozesstheologie Schöpfung als dynamisches Geschehen reformulieren. Dazu wird zunächst der Panentheismus als Gott-Welt-Verhältnis vorausgesetzt, d. h. alles ist in Gott, wird von ihm durchdrungen und umfangen, so dass Gott immanent, aber auch transzendent gedacht wird. Dadurch lässt sich „jedes neue Ereignis in der Schöpfung als das Ergebnis des Zusammenspiels ihrer eigenen Aktivität und des göttlichen Wirkens“ verstehen: „Immer und ausnahmslos sind beide zusammen am Werk, Gott und die Natur, göttliches Schöpfungshandeln und die Evolution“ (38) etc. Hier wird weiter ausbuchstabiert, was Lüke mit Teilhard auf die Kurzformel „Gott macht, dass die Dinge sich selber machen“ gebracht hat.
Das alles dürfte weder neu noch strittig sein. Die Innovation setzt beim Gottesbild an: „Da Gott ein veränderliches Universum in sich berge, muss er … als selbst in der Zeit veränderlich und von den Geschehnissen in der Welt beeinflusst“ (37) gedacht werden. Aus Gottes Sein wird Gottes Werden und aus unveränderlicher Substanz wird Prozess.
Dass ein solches Gottesbild „irritiert und provoziert“ (38) weiß die Autorin. Daher erschiene es mir wünschenswert, wenn die prozesstheologische Neuinterpretation mehr in Kontinuität zur klassischen Gotteslehre konzipiert werden könnte. Um diese Kontinuität wird freilich schon lange gerungen. So hat schon Karl Rahner nach einem Modell gesucht, um Unveränderlichkeit und Werden zu verbinden: „Gott kann etwas werden. Der an sich selbst Unveränderliche kann selber am anderen veränderlich sein“ (Grundkurs 218f.). Rahner räumt dabei ein, dass dieses Modell „nicht eine positiv durchschaute Versöhnung des Dogmas von der Unveränderlichkeit Gottes und von dem Werdenkönnen des ewigen Logos anbieten will“, aber es sei eine Formulierung, „die beides ernsthaft und deutlich aufrechterhält“ (ebd. 219).
Durchaus in der Linie dieser Rahnervorlage wird die für Herbst 2016 angekündigte Prozesstheologie Bernhard Dörrs (Trinitarische Prozess-Kosmologie, Paderborn : Schöningh, September 2016) genau diese Verbindung zur klassischen Gotteslehre versuchen (siehe auch den Beitrag Dörrs). Man darf gespannt sein, wie argumentativ überzeugend es gelingt, diesen von Pemsel-Maier hier skizzierten, vielversprechenden Ansatzes traditionell anschlussfähig zu machen.
Creatio Continua statt Kreationismus
Der Biologe und ehem. Weltanschauungsbeauftragte der Evang. Kirche, Hansjörg Hemminger gibt einen Einblick in Ausprägung und Argumentation des Kreationismus. Im Zentrum steht das von der Mainstream-Theologie beider Konfessionen abweichende Bibelverständnis, das auch die Schöpfungserzählungen wörtlich und historisch versteht – ganz anders, als der Beitrag von Erich Zenger im vorliegenden Heft, für den die Genesistexte Ur-Geschichte und deshalb gerade nicht Geschichte sind.
An der Variante des „Intelligent Design“ kritisiert Hemminger die missbräuchliche Verwendung der Wahrscheinlichkeitsrechnung, durch die die Entstehung komplexer Organismen so unwahrscheinlich dargestellt wird, dass sich die Annahme eines „intelligenten Designers“ zwangsläufig nahelege. Der Berechnungsfehler liege darin, dass die Schritte, die zu einem komplexen Gebilde notwendig sind, als unabhängig voneinander kalkuliert werden. Dabei hängt „jeder Schritt … von dem Ergebnis des vorauslaufenden Schrittes ab und wird durch ihn wahrscheinlicher“ (43).
Insgesamt ist die Ablehnung der Evolution für Hemminger theologisch geradezu kontraproduktiv: „Die Evolution passt in mancher Hinsicht besser zum biblischen Schöpfungsglauben als der Kreationismus. Zum Beispiel macht sie die alte Idee einer fortlaufenden Schöpfung, einer creatio continua, leichter zugänglich.“ Auch andere „tiefen Bilder von Gott und Welt verblassen, wenn wir uns als Christen von der Wissenschaft abzuschirmen suchen“ (46).
Naturwissenschaften im Islam
Die Frage nach dem Kreationismus wird von Helga Kaiser auch an den Islam herangetragen, da kreationistisches Gedankengut in islamischen Ländern weit verbreitet sei. Die Antwort des Islamwissenschaftlers Serdar Günes, der auf die Grenzfragen Religion und Naturwissenschaft einen Schwerpunkt gelegt hat, überrascht: „Der Kreationismus – mit Fokus auf der Ablehnung der Evolutionstheorie – war vor den 1980er-Jahren kein Thema in der Türkei“. Erst später galt er aus politisch-antiwestlichen Gründen „als Bollwerk gegen Darwinismus und Materialismus – also gegen etwas, was westlich war“ (49). Entsprechend erwartet Günes eine Verbesserung vor allem durch die „Präsenz der Muslime im Westen“, wo „Muslime Teil einer wissenschaftlichen Vielfalt“ sind. In Sachen Schöpfungstheologie und Bezug zur Evolutionstheorie verzeichnet Günes zwar Nachholbedarf und man könne „bei den christlichen Kollegen und Kolleginnen einiges abschauen“ (50f.), aber er sieht „schon an einigen Stellen ein Umdenken“. Und Umdenken setzt voraus, „dass sie ein gewisses Maß an Forschungs- und Meinungsfreiheit haben – in Deutschland etwa ist das möglich“ (51).
Evolutionstheorie ist weltanschaulich neutral
Das „Bollwerk gegen Darwinismus“ mag in manchen Teilen der Welt politisch begründet sein, religiös jedenfalls ist es unbegründet. Das jedenfalls führt Hemminger in einem zweiten Beitrag ins Feld, wenn er zunächst einmal von Darwin behauptet: „Darwin wollte nicht, dass seine Wissenschaft zur Kirchen- und Religionskritik benutzt wurde“ (53, so auch Eve-Marie Engels …), auch wenn er im Alter zum Agnostiker wurde. Die weltanschauliche Neutralität der Evolutionstheorie ändert sich auch nicht mit ihrem fortschreitenden Ausbau und gesteigerter Erklärungskraft – und diesem Aspekt ist der Beitrag primär gewidmet. Dieser Ausbau wird weiter gehen, denn „die Evolutionstheorie ist nicht fertig – naturwissenschaftliche Großtheorien sind nie fertig“. Daraus wird korrekterweise kein theologischer Honig gesogen. Aber: „Wie man ihre Ergebnisse weltanschaulich deutet, ist offen“ (55). Damit sind wir wieder bei Lükes „Dialektik von Erklären und Deuten“, was konfessionsübergreifend einen dialogtheoretischen Konsens anzudeuten scheint.
Religion als Evolutionsprodukt
Eine Dialogmöglichkeit sieht Christian Wetz in der „Evolutionären Psychologie“, wenn es darum geht, „zwischen geistes- und naturwissenschaftlichem Menschenbild zu vermitteln“ (57). Denn nicht nur der Körper des Menschen ist Produkt der Evolution, auch seine psychisch-geistigen Fähigkeiten. Am Anfang steht kein leeres Gehirn, das dann durch die Kultur geprägt wird, sondern auch hier gilt: „Die Anlage ist genetisch bedingt, die Ausprägung aber wird individuell durch die (v. a. soziale) Umwelt beeinflusst“ (56). Dadurch könne die ewige Nature-Nurture-Debatte (angeboren vs. anerzogen) befriedigt werden, und Kultur (damit auch Religion) ist kein feindliches Gegenüber der Natur, sondern integraler Bestandteil der Natur. Näherhin ist der „evolutionspsychologische Aufhänger von Religiosität“ der menschliche Drang, hinter (auch toten) Gegenständen oder Ereignissen lebendige Akteure zu vermuten: „Ein Gesicht in den Wolken zu erkennen ist besser, als in der Dunkelheit ein Raubtier zu übersehen … – und somit ein Selektionsvorteil“ (57).
Wenn die evolutive Entstehung von Religiosität darin erblickt wird, dass „unsere Vorfahren in toten Gegenständen Lebewesen zu erkennen vermeinten“ (57), dann schleicht sich allerdings schnell der Illusionsverdacht ein: Ein Gott, der sich zur Natur verhält, wie ein Gesicht zur Wolke, ist ein reines Epiphänomen. Hier müsste noch argumentativ nachgelegt werden, wenn gezeigt werden soll, dass Religion auch als evolutives Nebenprodukt Wirklichkeitsbezug aufweisen kann. Auch in dieser Hinsicht ist dann die Evolutionstheorie keine Bedrohung für den Schöpfungsglauben.
Tatsache und Geheimnis kommen im Staunen zusammen
Eine Bedrohung entsteht dann – so der Religionspädagoge Rainer Oberthür in dem nächsten Beitrag –, wenn eine Perspektive ernsthaft meint, „die Welt vollständig erklären zu können, also die Spannung und jeweils begrenzte Wahrheit verschiedener Sichtweisen nicht aushalten zu können“ (59). Daher plädiert Oberthür zunächst (!) für eine Trennung von Evolution und Schöpfung, wohlgemerkt „aber nur im Sinne des Unterscheidens und nicht im Sinne der Entscheidens“ (59). Deshalb geht der Autor der Frage nach dem Anfang „auf zweifache, unterscheidend trennende und dennoch aufeinander beziehbare Weise“ (60) nach. Wie in seinem Buch „Das Buch vom Anfang von allem“ erzählt Oberthür zunächst „die naturwissenschaftliche und die biblische Geschichte getrennt voneinander“ (60), um schließlich „die Fäden vorsichtig zusammenzuführen und die Wahrheit beider zu betonen, die größere Wahrheit beider zusammen hervorzuheben und zugleich die Grenzen der Wahrheitsfindung nicht auszublenden“ (62). Die beiden Geschichte gehen nun entsprechend Oberthürs „persönlichem Leitgedanken“ (59) ineinander über: „Alle Dinge, die wir sehen, können wir doppelt anschauen: als Tatsache und als Geheimnis. Nun kommen Tatsache und Geheimnis im Staunen zusammen: Vordergrund und Hintergrund, Außen und Innen, Oberfläche und Tiefe. Wenn wir die Tatsachen kennen, können wir staunen, können nach dem Geheimnis und nach Gott fragen.“ (62f.)
Während vorwiegend von einer zweifache Perspektive (Tatsache und Geheimnis) die Rede ist, kennt Oberthür zu Beginn seines Beitrags eine dreifache Sichtweise. Denn er will „das Geheimnis jenseits allen Erklärens und Deutens bewahren“ (59). Dies hätte in Lükes „Dialektik von Erklären und Deuten“ (17) noch das Geheimnis eingetragen, was ich für eine spannende Systematisierung gehalten hätte.
Stattdessen spielt das Trio Erklären, Deuten, Geheimnis im Folgenden und in Oberthürs Buch keine weitere Rolle mehr, sondern wird auf das Duo Tatsache und Geheimnis reduziert. Assoziativ kommt es dadurch zu folgenden Identifizierungen:
| … doppelt anschauen: als | Tatsache | und als | Geheimnis. | |
| Aus dem | Wirklichen | erwächst das | Erstaunliche. | |
| Naturwissenschaft | und | Glaube | kommen im Staunen zusammen. (59) | |
| Nun kommen | Tatsache | und | Geheimnis | im Staunen zusammen. (62) |
Man kann diese Identifizierungen gewiss richtig verstehen, allerdings lauern hier zwei Gefahren.
- So ist der Glaube zwar in der Tat auf das Geheimnis verwiesen (und die Theologie versteht sich wesentlich als Anwalt des Geheimnisses), aber er ist auch mehr als das, er kennt auch positive Bestimmungen, die zur Deutung des naturwissenschaftlich Eingebrachten herangezogen werden. Ohne diese Bestimmungen reduziert sich der Gesprächspartner leicht auf eine negative Theologie.
- Die Identifizierung von Naturwissenschaft mit „Wirklichem“ und „Tatsachen“, die Identifizierung von Glaube mit „Geheimnis“ spielt eine Steilvorlage in die falsche Richtung. Atheistisch gestimmte Naturwissenschaftler nehmen den Ball gerne auf als Gewinn für ein Schwarz-Weiß-Denken, in dem die Naturwissenschaft objektiv, auf Tatsachen beruhende Realwissenschaft ist, während die Theologie als geheimnisumwitterte, spekulative, beliebige, subjektive Verbalwissenschaft allenfalls ins Reich des Privatvergnügens gehört, nicht aber in den öffentlichen Diskurs. (Vgl. U. Kutschera, Das Dobzhansky-Mayr-Prinzip und eine Analogiebetrachtung, in: Ders. (Hg.), Kreationismus in Deutschland, Berlin 2007, 352-363. Ders., Evolutionsbiologie, 2. Aufl., Stuttgart 2006, 12f.)
Meines Erachtens wären diese Gefahren durch das Trio Erklären, Deuten, Geheimnis besser zu vermeiden gewesen, was aber den Eindruck des Grundkonzepts, die am Ende zusammengeführte Doppelerzählung, kaum schmälert. Dabei bleibt auch der Grundkonsens („Naturwissenschaft und Glaube kommen im Staunen zusammen“), der zudem zwanglos an die Einführung des Themenheftes rückbindet, wo es hieß: „Forschende und Glaubende können gemeinsam mit Begeisterung staunen“ (9).
Fazit
 Der gute Ersteindruck hat sich durch die Lektüre inhaltlich bestätigt. Das in bestem Sinne populär geschriebene Heft bietet nicht nur einen breit gefächerten, verlässlichen Einblick in den derzeitigen interdisziplinären Stand des Schwerpunktthemas, darüber hinaus finden sich aktuell anstehende Zukunftsthemen: So befindet sich der Dialog des Islam mit den Naturwissenschaften noch am Anfang, und die Potenziale einer Prozesstheologie sind für die Schöpfungslehre künftig fruchtbar zu machen.
Der gute Ersteindruck hat sich durch die Lektüre inhaltlich bestätigt. Das in bestem Sinne populär geschriebene Heft bietet nicht nur einen breit gefächerten, verlässlichen Einblick in den derzeitigen interdisziplinären Stand des Schwerpunktthemas, darüber hinaus finden sich aktuell anstehende Zukunftsthemen: So befindet sich der Dialog des Islam mit den Naturwissenschaften noch am Anfang, und die Potenziale einer Prozesstheologie sind für die Schöpfungslehre künftig fruchtbar zu machen.
Dass das Heft nur einen ersten Einblick bieten kann, war aufgrund des Seitenumfangs bei gleichzeitiger Themenbreite nicht anders zu erwarten. Wer neugierig geworden ist, kann über die Lesetipps am Ende eines jeden Beitrags und als Abschluss des Themenschwerpunkts (64f.) Tiefenbohrungen vornehmen.
Entsprechend ist das Heft „Die Schöpfung: Bibel kontra Naturwissenschaft?“ für einen niederschwelligen Einstieg in das spannende Feld des Dialogs zwischen Naturwissenschaft und Schöpfungsglaube eine wirklich gute Leseempfehlung.



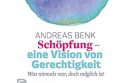








Recent Comments